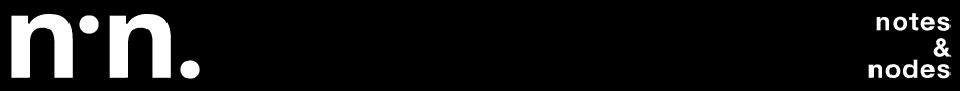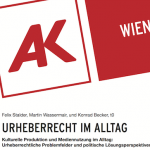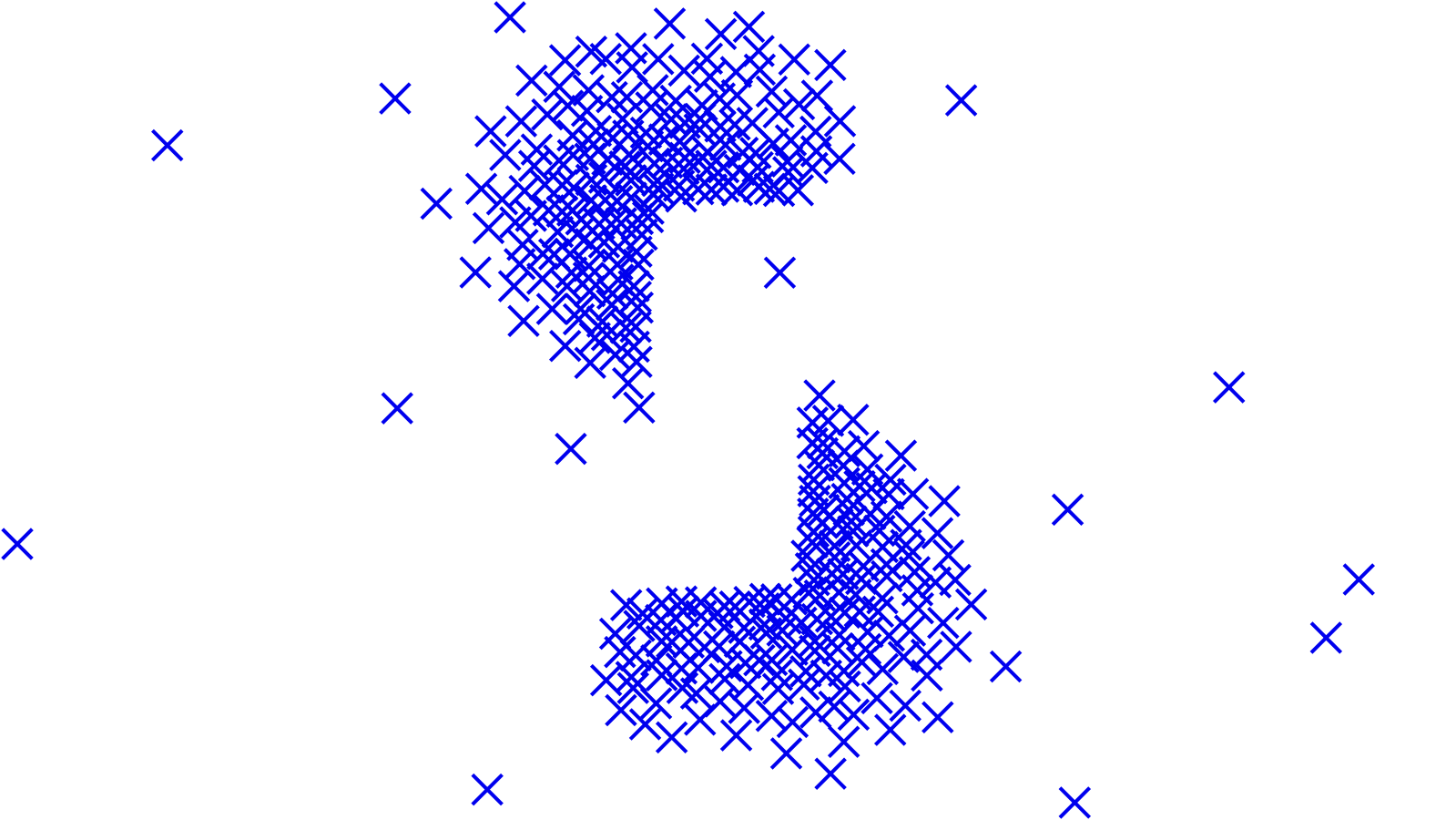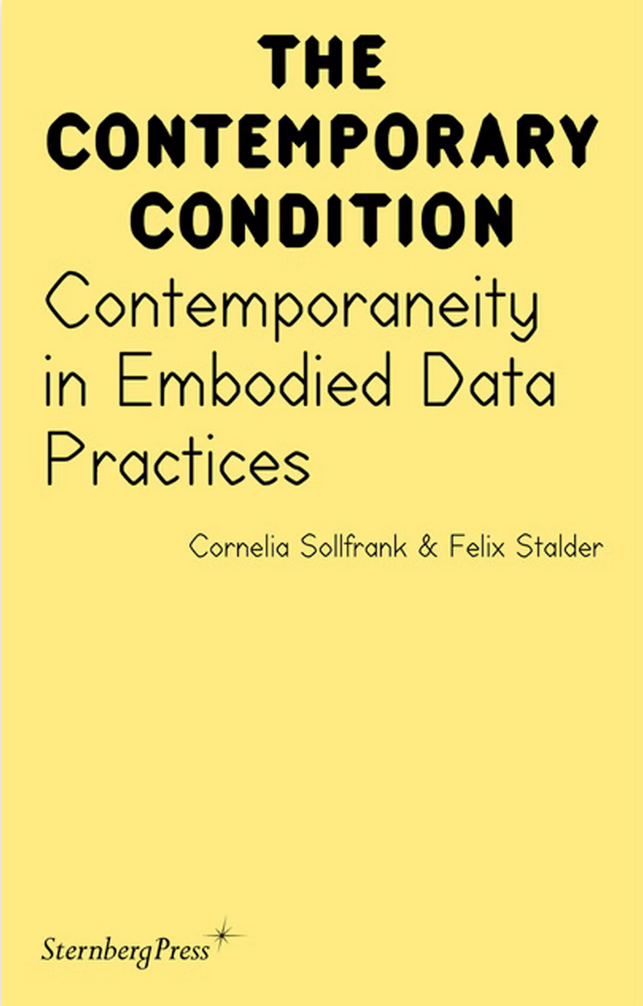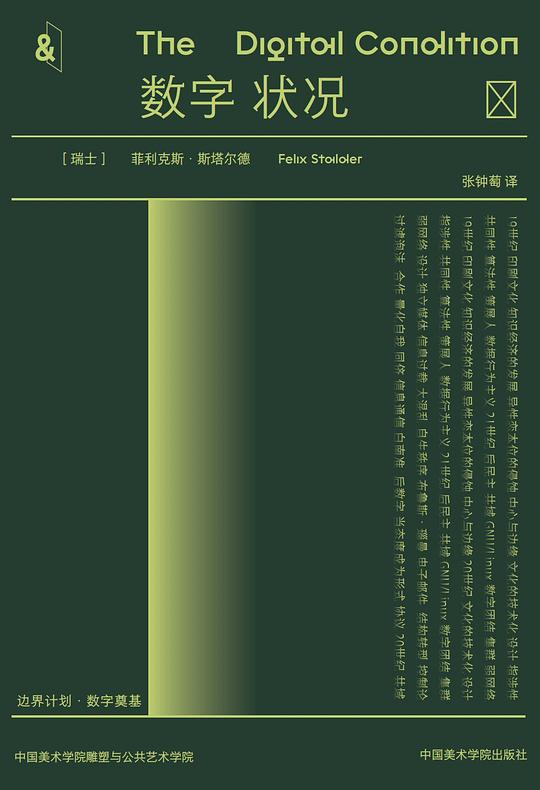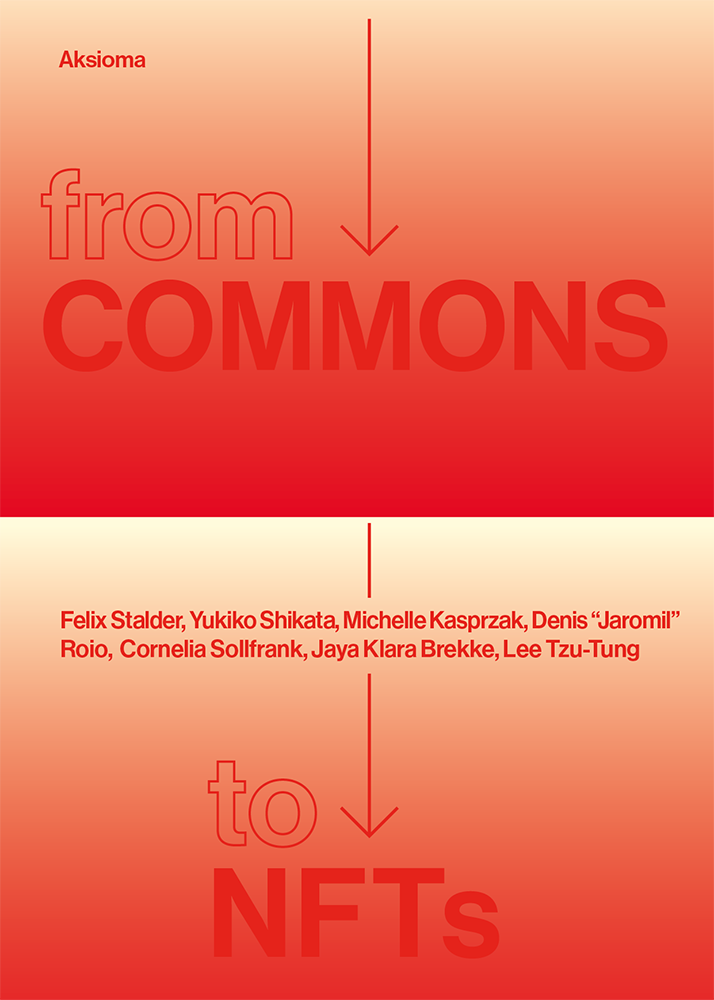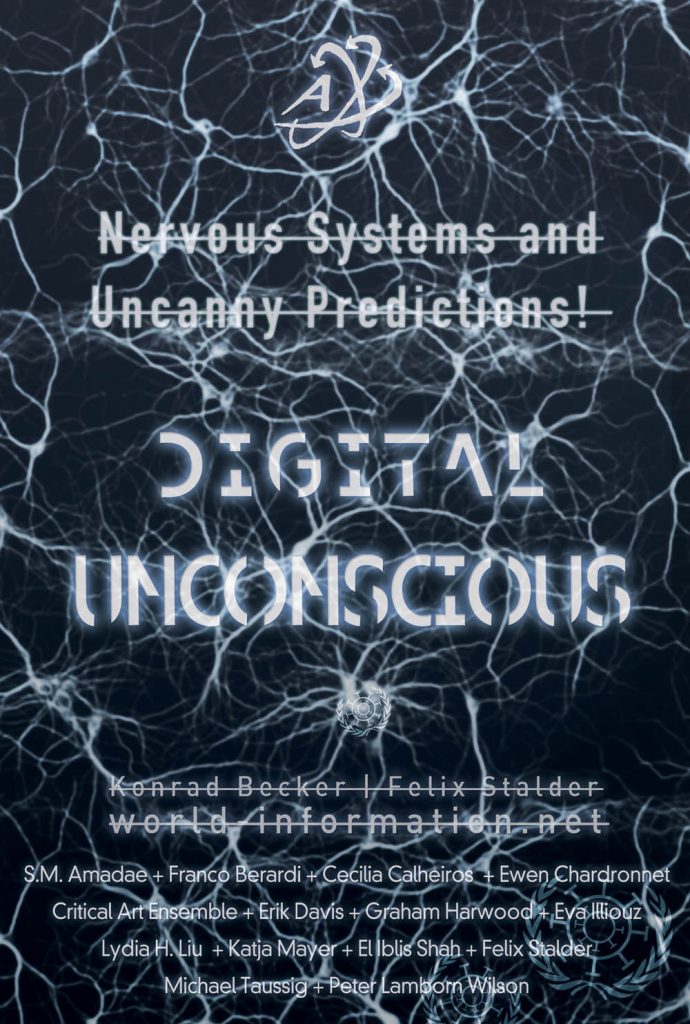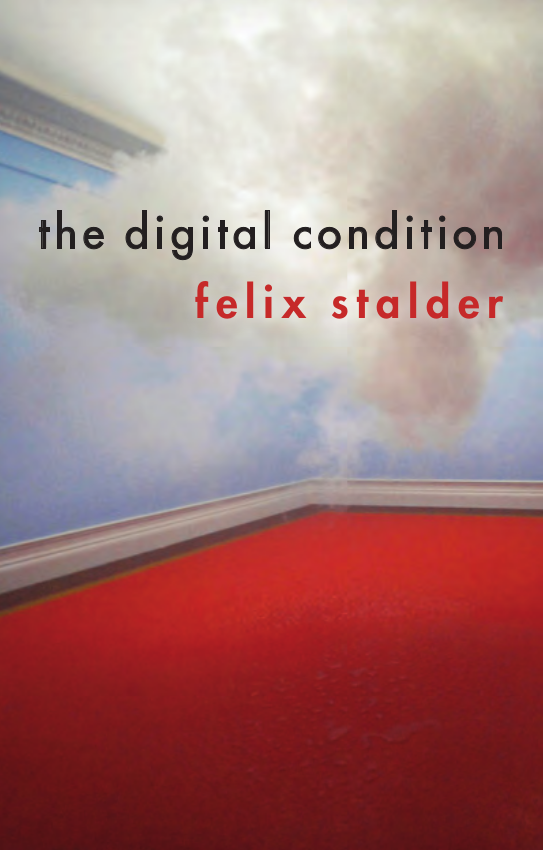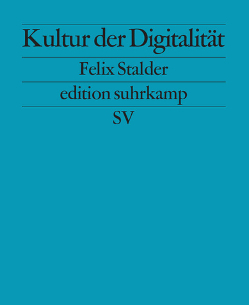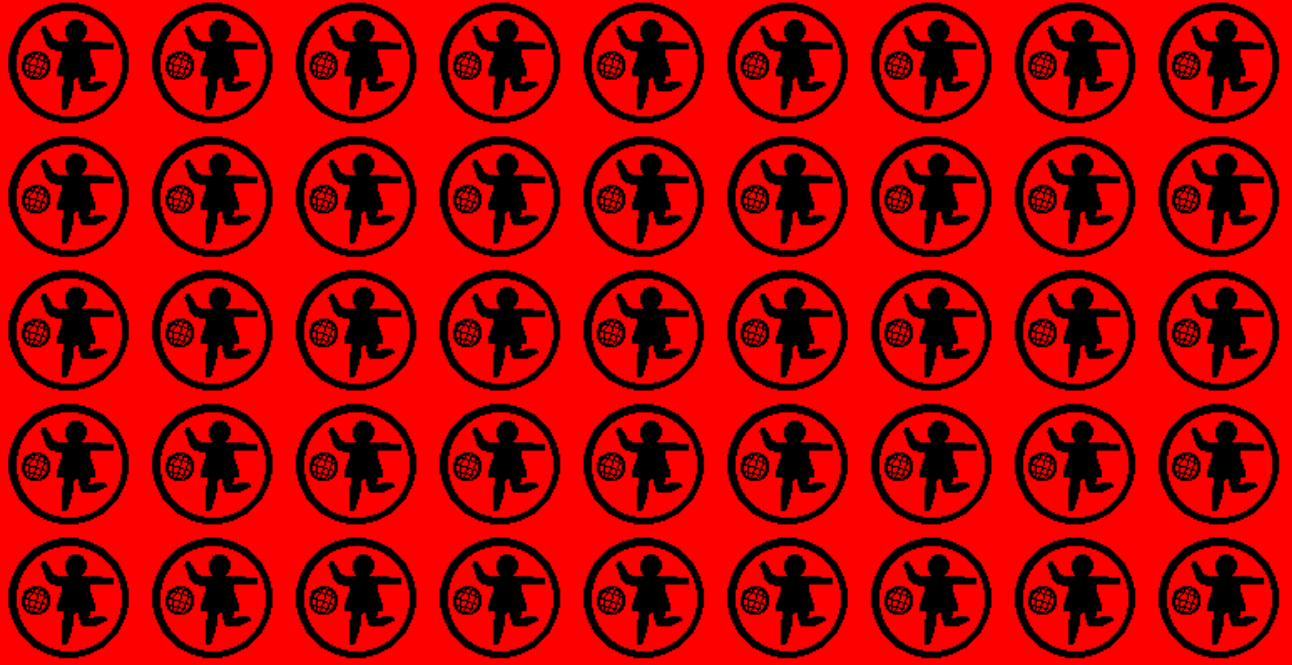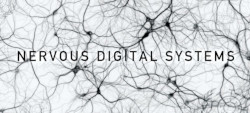Der Hacker als Produzent (Buchkapitel)
20 October, 2014 - 11:31 by felix Update, 11.02.2014 Unter dem, eigentlich viel besseren, Titel "Autorschaft und Freiheit" bei den Freunden in der Berliner Gazette republiziert.
Update, 11.02.2014 Unter dem, eigentlich viel besseren, Titel "Autorschaft und Freiheit" bei den Freunden in der Berliner Gazette republiziert.
Soeben erschienen! "Hacking" (Edition Digital Culture 2). Herausgegeben von Dominik Landwehr, Migros Kulturprozent & Christoph Merian Verlag Basel, Okt. 2014. Mit Beiträgen von: Hannes Gassert, Verena Kuni, Claus Pias, Felix Stalder und Raffael Dörig. Hier ist meiner.
Künstler und Hacker sind beides zeitgenössische Typen eigenwilliger Autorschaft. Sie verkörpern auf unterschiedliche Art, Ansätze was es heisst, heute als autonomer Produzent, und nicht etwa als Auftragnehmer, tätig zu sein. Als Grundlage ihrer Autonomie entwerfen sie jedoch sich diametral widersprechende Vorstellung von Freiheit. Für den Künstler steht Freiheit im emphatischen Sinn am Anfang seiner Arbeit. Diese Freiheit rechtfertigt oder erfordert gar einen demiurgischen Akt der Setzung, aus dem heraus sich die Arbeit entfaltet und der die enge Verbindung zwischen „Autor“ und „Werk“ begründet. Der Hacker hingegen beginnt mit der Erfahrung grösster Unfreiheit. Die Arbeit des Hackers entfaltet sich in der Auseinandersetzung mit einem übermächtigen System,1 in dem, auf den ersten Blick, alle Handlungsoptionen (fremd)bestimmt sind. Sich dennoch Momente der Freiheit zu erobern, ist das Ziel des Hackers.