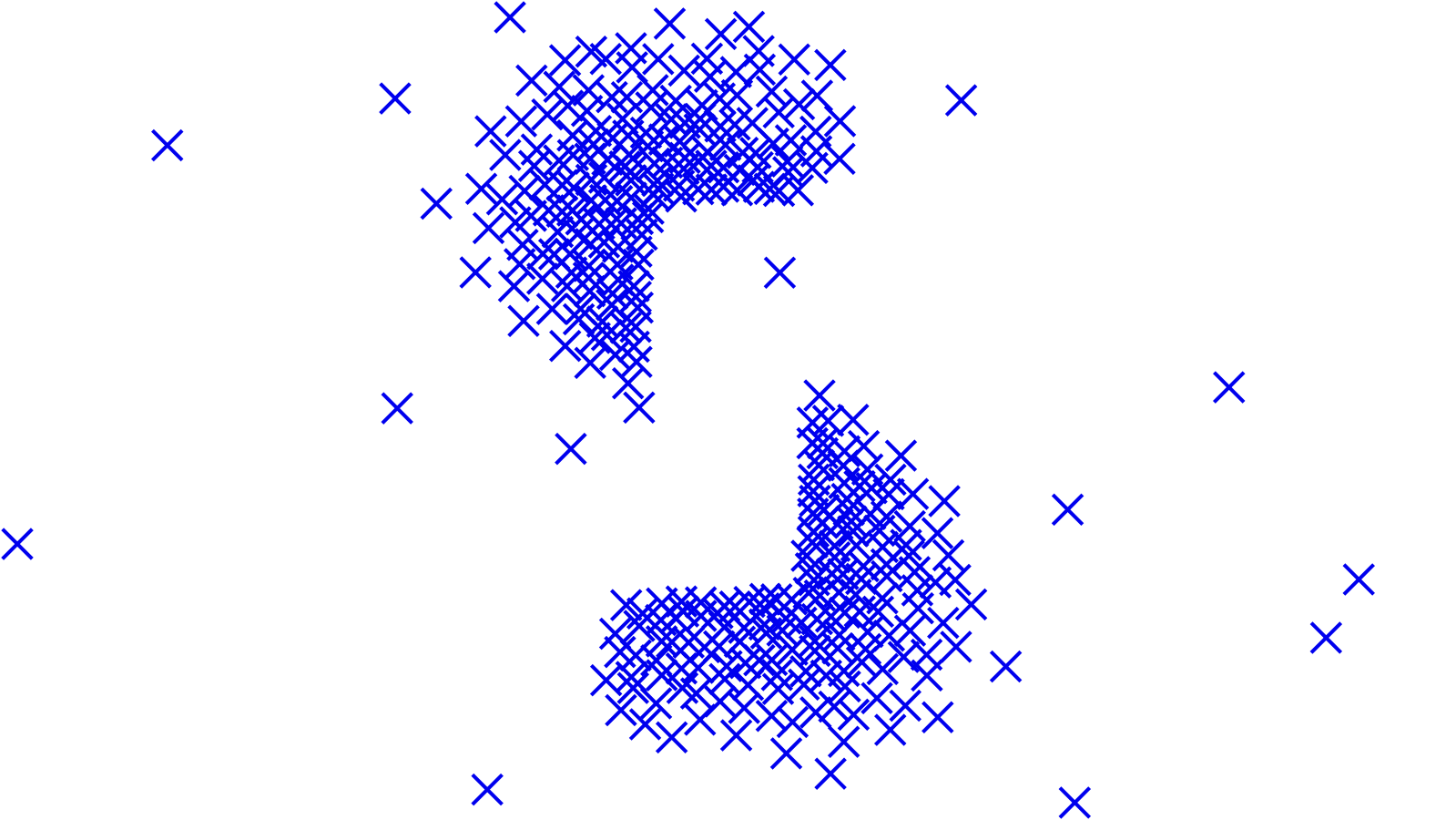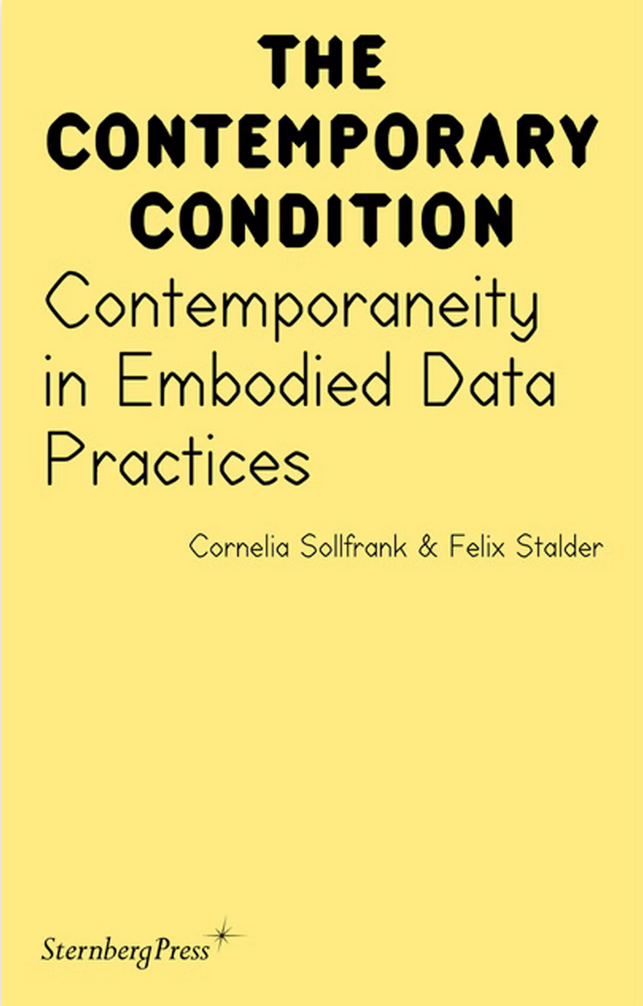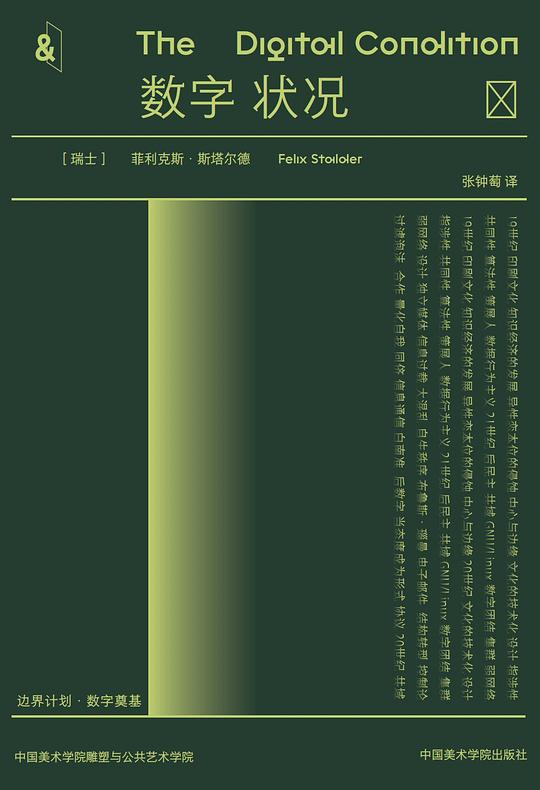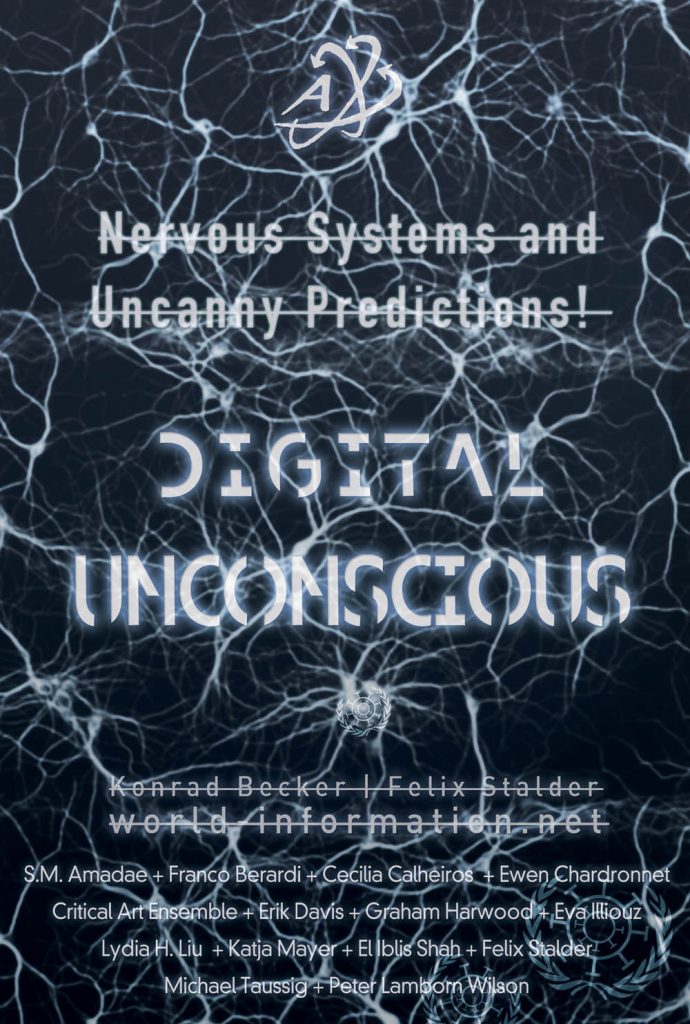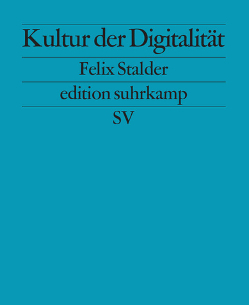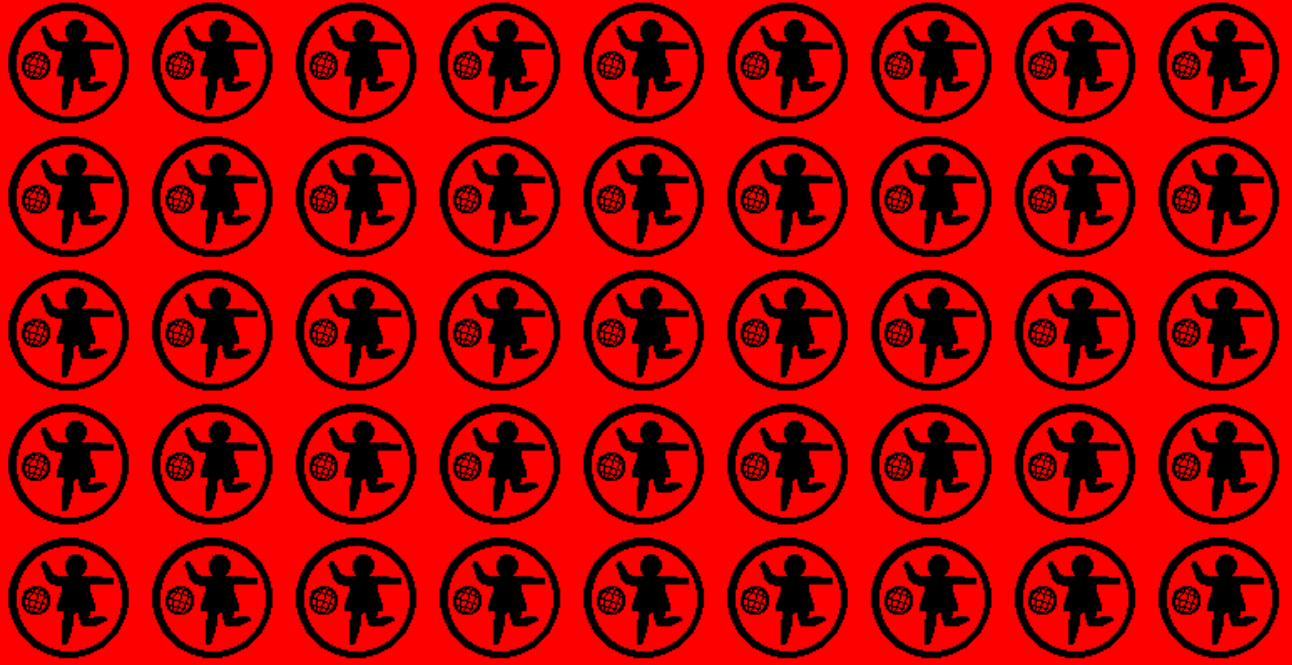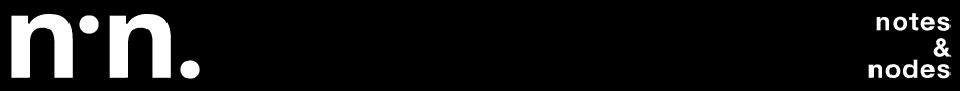
 Die Vorstellung, dass Kulturen, sowohl als ganzes wie auch ihre einzelnen Manifestationen, aus Mischungen, Wandlungen, Verschiebungen, Bearbeitungen und Neuformierungen unterschiedlichster Elemente bestehen, bereitet uns Unbehagen. Das Aufkommen einer „Remix Kultur“, in der das Neue nie einfach nur neu ist, sondern immer unter explizitem Einbezug unterschiedlichster Elemente des Alten artikuliert wird, wird von vielen als Niedergang der (abendländischen) Kultur empfunden. Besonders sichtbar wird dies in der Auseinandersetzungen um das Urheberrecht, die deutlich an Schärfe zugenommen haben. In der ZEIT vom 10. Mai, 2012 sahen Autoren eine der „zentralen Errungenschaften der bürgerlichen Freiheit“ bedroht, kurz darauf bezeichnen Musikschaffende die Schweiz als „Urheberrechts-Guantánamo in Europa“, weil die relativ liberale Gesetzgebung sie ihrer fundamentalen Rechte beraube.
Die Vorstellung, dass Kulturen, sowohl als ganzes wie auch ihre einzelnen Manifestationen, aus Mischungen, Wandlungen, Verschiebungen, Bearbeitungen und Neuformierungen unterschiedlichster Elemente bestehen, bereitet uns Unbehagen. Das Aufkommen einer „Remix Kultur“, in der das Neue nie einfach nur neu ist, sondern immer unter explizitem Einbezug unterschiedlichster Elemente des Alten artikuliert wird, wird von vielen als Niedergang der (abendländischen) Kultur empfunden. Besonders sichtbar wird dies in der Auseinandersetzungen um das Urheberrecht, die deutlich an Schärfe zugenommen haben. In der ZEIT vom 10. Mai, 2012 sahen Autoren eine der „zentralen Errungenschaften der bürgerlichen Freiheit“ bedroht, kurz darauf bezeichnen Musikschaffende die Schweiz als „Urheberrechts-Guantánamo in Europa“, weil die relativ liberale Gesetzgebung sie ihrer fundamentalen Rechte beraube.
Was steckt hinter diesen schrillen Tönen? Nicht zuletzt eine zunehmend problematische Konzeption von Autorschaft als Urheberschaft. Diese soll im folgenden beleuchtet und mit einer zeitgemässeren Konzeption von Autorschaft kontrastiert werden.
Fraglos gibt es auch handfeste wirtschaftliche Gründe für die schrillen Töne. Geschäftsmodelle, die auf dem Vertrieb einer beschränkten Anzahl stabiler Kopien beruhen, sind im digitalen Kontext schwierig aufrecht zu erhalten. Jeder kann heute endlos Kopien anfertigen, diese verändern und effizient global zu Verfügung stellen. Hier sträubt sich eine Industrie gegen einen Strukturwandel, den sie als lebensbedrohlich empfindet. Dies ist keine ungewöhnliche Situation, sondern begleitet den Niedergang des fordistischen Produktionsmodell (zentral hergestellte Massenware für den Absatz auf grossen Märkten) schon seit bald 40 Jahren.
Das ist aber eben nicht alles. Hier wird auch eine ideologische Auseinandersetzung geführt, eine Auseinandersetzung um das Verfasstheit der Kultur und den Status der Kulturproduzenten. Und diese Auseinandersetzung berührt tatsächlich den Kern der bürgerlichen Gesellschaft, auch wenn das keineswegs zu einem Verlust an Freiheiten führen muss. Auch das Gegenteil, ein enormer Freiheitsgewinn könnte der Fall sein. Was die Diskussion so verworren macht, ist das auch diese zweite, ideologische Ebene der Auseinandersetzung über das Urheberrecht ausgetragen wird.
Die Figur des Urhebers
Das zentrale Anliegen des europäischen Urheberrecht ist der “Schutz der Urheber und Urheberinnen von Werken der Literatur und Kunst.” So steht es etwa in § 1a des Schweizer Urheberrechts. Aktuell wird viel und kontrovers diskutiert über Fragen des Schutzes, wie weit er gewährleistet werden kann oder gar gewährleistet werden soll, welche Massennahmen zu ergreifen sind und welche gesellschaftlichen und kulturellen Folgen diese nach sich ziehen könnten. Erstaunlich wenig wird über den Begriff des “Urhebers” selbst diskutiert. § 6 definiert ihn folgendermassen: “Urheber oder Urheberin ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat.” Das klingt zunächst absolut banal und harmlos, ja für ein Gesetzestext erscheint das ungewöhnlich nahe am gesunden Menschenverstand. Aber bei genauerem Hinsehen entpuppt sich der gesunde Menschenverstand, wie so oft, nur als eine Verdichtung gut sedimentierter Vorurteile. Denn diese Definition des Urhebers ist keineswegs nur eine einfache Beschreibung eines Sachverhalts, sondern sie kodifiziert ein ganz bestimmte Vorstellung über das Verhältnis von Autor, Werk und Öffentlichkeit, über die Struktur von Kultur im allgemeinen.
Wenn wir die Begriffe “Urheber” und “Schöpfung” ausserhalb des rechtlichen Kontextes stellen, dann springt uns ihr religiöser Charakter sofort ins Auge. Das Alte Testament (Moses, Kap. 1) beginnt, in der klassischen Formulierung von Martin Luther (1483-1546), mit den Worten: “Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer … [u]nd Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht.” Zunächst ist also nichts, dann, plötzlich, ist etwas. Ein einzigartiger Akteur besitzt die aussergewöhnliche Fähigkeit, nur durch seinen Willen, artikuliert durch das Wort, aus diesem Nichts etwas zu schöpfen. Akteur, Wille und Wort bilden hierbei eine Einheit, wie Luther im berühmten Anfang des Johannes Evangeliums erklärt, denn “im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.” Bis ins hohe Mittelalter war es undenkbar, diese schöpferische Kraft einem Menschen zu zu sprechen. Denn jede Bewegung in der Welt verwies immer auf eine davor liegende Bewegung, die schliesslich zu Gott als dem “unbewegten Beweger” zurückführte. Für Thomas von Aquin (1225-1274) war dieses kinetische Paradox der ersten Bewegung, auf das Aristoteles als erster hingewiesen hatte, einer von fünf möglichen Gottesbeweisen.
Erst in der mit der Renaissance einsetzenden Säkularisierung begannen sich Autoren nicht mehr als Interpreten oder Kommentatoren zu verstehen, sondern übernahmen selbst die Rolle des Schöpfers. Die metaphysische Verbindung wurde gekappt, oder zumindest auf die Funktion der Inspiration reduziert, und der Mensch setzte sich selbst an den Anfang einer Bewegung. Dies war zunächst eine ideelle Verschiebung. Ökonomisch und sozial blieb alles beim Alten. Künstler und Autoren blieben von Auftragsgebern abhängig und standen sozial auf der Stufe höfischer Hausangestellter. Daraus entstand ein tiefer Konflikt zwischen Selbst- und Fremdwahrnehumg, der vielen Künstlerbiographien der frühen Neuzeit einen dramatischen Charakter verleiht. Die Tragik Mozarts – das verstandene Genie im Armengrab – wurde von Soziologen Norbert Elias etwa als das Scheitern eines modernen Künstler in einer höfischen Gesellschaft interpretiert. Erst die liberale Gesellschaftstheorie, insbesondere John Locke (1632-1704), vermochten diesen Konflikt zu lösen. Er erklärte, dass jeder Mensch frei und gleich sei, was sich darin ausdrücke, dass jeder in gleichem Masse Eigentümer seiner selbst, und damit seiner Arbeitskraft sei. Wurde die Arbeitskraft nicht verkauft, so erwarb man sich Eigentum an den Dingen, die man selbst mit eigenen Arbeitskraft schuf. Im Verlaufe des 18. und 19. Jahrhunderts schrieb das aufstrebende Bürgertums diesen Freiheitsbegriff, überall wo es an die Macht kam, in die neuen Staatsverfassungen ein.
Es ist an dieser Stelle nicht notwendig, diesen Freiheitsbegriff zu kritisieren, das ist in den letzten dreihundert Jahren ausführlich geschehen. Wichtig ist, dass er sich im Bereich des geistigen Eigentums nahtlos an die religiöse Idee der Schöpfung aus dem Nichts anschliesst. Denn während in der materiellen Welt die theoretische Begründung des Privateigentum auf der Arbeit des Überführens einer Sache aus ihrem Naturzustand den Kulturzustand beruht, ist im Bereich der Kultur der Rückgriff auf einen wie auch immer gearteten Naturzustand logisch unmöglich. Das alleinige Eigentum an einem kulturellen Werk des Autoren kann also nur mit seiner Schöpfung aus dem Nichts begründet werden. Darauf baut auch unsere Vorstellung von Originalität auf. Etwas, das sich nicht weiter zurückverfolgen lässt, nur auf sich selbst verweist, und damit einen neuen Anfang darstellt. Etwas wurde geschaffen, wo vorher nichts war. Originalität ist die zentrale Begründung des Eigentumsanspruchs. Gleichzeitig ist diese Vorstellung der Schöpferkraft auch die Grundlage des spezifischen Status des Autoren, als einer herausragenden, aussergewöhnlichen Persönlichkeit, die über die letztlich magische Fähigkeit verfügt, sich über die Naturgesetze, oder zumindest die gesellschaftlichen Konventionen, hinwegzusetzen und aus Nichts Etwas zu machen.
Das Ende der Magie
Eines der bedauerlichsten Opfer radikalen Entgrenzung der Kommunikation, die das Internet mit sich bringt, ist die Kunst der Magie. Für jeden noch so komplexen Zaubertrick sind heute auf Youtube eine Vielzahl von „How-To“ Videos, also detaillierte Anleitungen zum Selbermachen, zu finden. Auch wenn man nicht an Zauberei glaubt, ist es ein bedeutender Unterschied, ob man sich einer lustvollen (Selbst)täuschung hingeben kann, wenn man zwar weiss, dass man einen Trick sieht, aber nicht weiss, wie dieses Kunststück vollbracht wird, oder ob man genau weiss, die ein Trick funktioniert und nur noch die Virtuosität seiner Ausführung zu bestaunen bleibt.
Etwas ähnliches geschieht mit der Magie der Originalität. Konzentrierte, analytische Aufmerksamkeit macht ihr den Gar aus. Bei genauerer Betrachtung besteht jede Idee, der Ausdruck aus einer Vielzahl bereits gedachter Ideen und gemachter Handlungen, jeder Ursprung verlagert sich zurück in den Nebel der Geschichte. Nicht weil er dort anzusiedeln wäre, sondern weil der Nebel mit zunehmender Distanz immer dichter wird und irgendwann mal die Sicht versperrt, was natürlich keineswegs bedeutet, dass der Weg dahinter nicht weitergeht. Die Idee des Anfangs, die Figur des Urhebers, die Behauptung, dass ein Werk gänzlich der Absicht des Autoren entspricht, ist brüchig geworden. Dies ist nicht keine neue Erkenntnis, sondern Grundlage postmoderner Theorie und ästhetischer Praxis seit den 1970er Jahren.
Wir sind heute aber nicht mehr in der Postmoderne. Die Digitalisierung und Vernetzung hat diese Form der „Entzauberung“ enorm radikalisiert.
Erstens hat sie die Standardmethode der Kulturproduktion verändert. Galt einst der Autor in seiner Stube, der vor dem leeren Blatt sitzt (das Nichts), mit sich ringt (der Wille) um danach das Blatt mit seinen Gedanken zu füllen (die Schöpfung), als das paradigmatische Modell künstlerischer Arbeit – mit Variationen für andere Sparten, etwa Maler (die leere Leinwand), Bildhauer (der rohe Steinquader), oder Musiker (der taube Beethoven) – so ist dieses Bild merklich in den Hintergrund getreten. Standard geworden sind Tätigkeiten des Arrangierens, der Transformation, des Aufnehmens, des Eingehens, des Verbindens oder An- und Einpassens. Mit einem Wort, des Dialogs. Der DJ, der auf sein Publikum achtet, wenn er aus einem Set von bestehenden Aufnahmen, Samples, oder Sequenzen etwas zusammenstellt, ist das viel zitierte, paradigmatische Beispiel der digitalen Kulturproduktion.
Zweitens, der Kreis der Kulturproduzenten hat sich enorm verbreitert. War das Feld der bürgerlichen (Hoch)Kultur strikt eingeteilt in eine kleine Gruppe aktiver Produzenten und eine grosse Gruppe von mehr oder weniger stummen Rezipienten, so hat sich dies radikal verändert. In der Öffentlichkeit durch kulturelle Produktionen in Erscheinung zu treten ist im Zeitalter von Facebook, Twitter und Instagram nicht nur zu einer Massenaktivität geworden, sondern eine veränderte Wirtschaft und Gesellschaft verlangt solche Fähigkeiten im Grunde von allen. Kreativität ist nicht mehr eine privilegierende Fähigkeit, sondern ein gesellschaftlicher Imperativ. Durften einst einige wenige kreativ sein, so müssen das heute alle.
Drittens sind wir heute mit immer weniger „Natur“ und immer mehr „Kultur“ konfrontiert. Der Philosoph Peter Sloterdijk spricht, mit Hinweis auf die globale Erwärmung, die sogar das Wetter zu einem kulturellen Phänomen macht, vom Leben im „Weltinnenraum“. Wir sind aber nicht nur mit viel mehr kulturellem Material konfrontiert, sondern das Material selbst ist äusserst heterogen geworden. Die Ordnung des Archivs, wo jedes Objekt nach bestimmten Kriterien selektiert und in eine historische Erzählung eingebettet war (was natürlich Anlass zu vielerlei Debatten um den Charakter dieser Erzählungen gab), ist aufgebrochen. Unsere Kultur ist geprägt von der Logik der Datenbank. Und das zwar einer offenen Datenbank. Alle können Objekte einfügen, und je nach Abfrage, kann alles neben allem stehen. Wir treffen heute immer mehr kulturelle Objekte an, deren Kontext weitgehend unbekannt ist. Jede Google Abfrage führt uns dieses Problem von neuem vor Augen. Die Frage nach dem Ursprung tritt hinter ein viel dringlicheres Problem zurück: eine Kontext herzustellen, für das, was wir antreffen. Damit können und müssen wir, ad-hoc, eine neue, spezifische Bedeutung für diese offenen und mehrdeutigen Dinge mit denen wir es andauernd zu tun haben. Bruno Latour spricht in diesem Zusammenhang von „Quasi-Objekten“, Dingen, die zwar bereits existieren, ihre Bedeutung und Funktion aber erst erlangen, wenn sie in konkrete Netzwerke eingepasst werden.
Viertens haben sich auch Rezeptionskulturen verändert. Das Verständnis von kulturellen Objekten, die gleichzeitig eine Einheit und eine Vielheit sind, die auf den Autoren und über ihn hinaus weisen, ist weit verbreitet. Das Erforschung von Bezügen, Referenzen und direkten Übernahmen hat die wissenschaftlichen Seminare verlassen und ist mittels „crowd-sourcing“ zum Massenphänomen geworden. Das reicht von Gemeinschaften akribischer „Plagiatsjägern“ bis zu globalen communities obsessiver Fans. Zu jedem erfolgreichen Film etwa gibt es ein Forum, in die Bezüge und Verweise bis in die kleinsten Details aufgelistet und diskutiert werden. Das kann soweit gehen, dass sogar der Regisseur neues über seinen Film erfährt. Everything is a Remix ist nicht nur der Titel eines erfolgreichen dokumentarischen Episodenfilms, sondern taugt auch als Kurzformel eines zeitgenössischen, populären Kulturbegriffs.
Die Frage der Authentizität
Wenn wir den Remix als zentrale Methode des zeitgenössischen Kulturschaffens betrachten, bedeutet das auch, dass wir von einem veränderten Verhältnis von Autor, Werk und Öffentlichkeit ausgehen. Der Autor steht nun nicht mehr am Anfang des kreativen Prozesses, sondern in der Mitte. Es war etwas vor ihm – Material mit dem er zu arbeiten beginnt – und es wird etwas nach ihm sein – andere, die sein Werk wiederum zum Material ihrer Arbeit machen. Insofern ist das Werk wie gänzlich einem einzelnen Autor zu zu schreiben. Folglich wird auch der umfassende Eigentumsanspruch problematisch. Auf dem Gebiet der Kultur müssen wir also neue Formen des Eigentums finden, die zwischen umfassender, individueller Verfügungsgewalt („Werkherrschaft“) und Gemeinfreiheit („public domain“) angesiedelt sind. Dem kommt auch ein veränderter Charakter des Werks entgegen. Es rückt ebenfalls in die Mitte. Es ist nicht mehr das Ende des kreativen Prozesses, sondern eine spezifische Artikulation eines zeitlich und örtlich weit darüber hinaus reichenden Prozesses von Transformationen. Auch wenn das einzelne Werk sehr wohl abgeschlossen sein kann, ist der Prozess, aus dem das Werk überhaupt seine Bedeutung bezieht, immer offen. Der Versuch, die transformative Nutzung eines Werkes zu verhindern, bedeutet in dieser Perspektive, durchsetzen zu wollen, in einem Dialog das letzte Wort zu behalten, das heisst, ihn zu beenden. Im digitalen Kontext ist das im Grund nur ein kleines Problem, denn jede Werkbearbeitung schafft ein neues Werk, ohne das bestehende auszulöschen. Aber, aufgrund der Konzeption von Autorschaft als Urheberschaft ist es dennoch verboten, beziehungsweise bewilligungspflichtig. Die Öffentlichkeit ist im Modell des Remixes nicht mehr etwas, das am Ende, nachdem alle Arbeit getan ist, noch dazukommt, sondern etwas, das von Anfang an dabei ist. Sie trägt wesentlich dazu bei, überhaupt den Kontext der Produktion zu schaffen und dem Werk, im offenen Austausch, einen Sinn zu verleihen. Damit soll nicht der Tod des Autors und die Geburt des Lesers, knapp 50 Jahre nach Roland Barthes, nochmals begründet werden. Die Welt, in der wir leben, ist eine andere geworden. Der Hinweis auf die aktive Rolle des Publikums gilt der Brüchigkeit jedes kulturellen Kontextes in einer dynamischen, heterogenen und fragmentierten globalen Gesellschaft. Heute muss jede kulturelle Gemeinschaft ihren eigenen Kontext aktiv und kontinuierlich (re)produzieren. Diese Herausforderung, die einst bedrohte Subkulturen auszeichnete, ist heute für alle kulturellen Nischen, ob gross oder klein, prägend geworden.
Genau für diese Herausforderung bietet der Remix passende Strategien. Er stellt seine heterogenen Bestandteile offen zur Schau. Diese Bestandteile zu verstehen, und die Bezüge zu produzieren, sie mit eigenen Interpretationen anzureichern, eine weitere Versionen hinzuzufügen, diesen Kontext, der im Remix als Möglichkeit angelegt ist, als lebende Wirklichkeit zu produzieren ist die neue Aufgabe des teilnehmenden Publikums.
In einer solchen Perspektive wird die Frage nach Originalität bedeutungslos. Im Chaos globalisierter, digitalisierter Kultur nach dem Ursprung zu suchen, gleicht in einem Sturm danach zu fragen, welcher Schmetterling ihn nun ausgelöst habe. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Möglichkeiten mehr gibt, Unterschiede festzustellen. Nicht alles ist gleich. Nicht alles ist interessant. Nicht alles ist wertvoll. Nur dass an die Stelle der Frage der Originalität die Frage der Authentizität tritt. Authentizität ist schillernder Begriff, der mit einer vielfältigen und für unsere Zwecke oftmals problematischen Geschichte befrachtet ist. Er soll hier nicht üblichen, rückwärtsgewandten Sinne verstanden werden. Die Reinheit, die Echtheit der Quellen, wie die Historiker den Begriff benutzen, steht nicht im Vordergrund. Ebenso wenig hilfreich ist die romantische Vorstellung von Authentizität, die einen Rückgriff auf Zustände, wie sie vor der Korruption durch die rationalisierende Moderne bestanden, sucht. Der Begriff der Authentizität, um den es hier geht, ist konsequent in die Gegenwart gedreht. Allerdings soll er nicht, wie im Existenzialismus und der Psychologie, auf das individuelle Subjekt (das authentische Leben) bezogen sein, sondern, auf kollektive Verhältnisse, Netzwerke und Situationen. Diese Verhältnisse sind aber nicht einfach vorzufinden, wie das die strukturalistische Anthropologie dachte (etwa in „traditionelle Stammeskulturen“), sondern sie werden aktiv und bewussst (re)produziert. Es geht also nicht um die Errettung, sondern um die Schaffung von Authentizität. Diese ist damit nicht essentialistisch, sondern perfomativ zu verstehen.
Gelingt es einer kulturellen Handlung, eine neue Realität herzustellen, eine Kontext, der im hier und jetzt mit Leben und Bedeutung erfüllt ist, oder bleibt sie auf der Ebene der Simulation (etwa wenn von der Authentizität einer Marke gesprochen wird). Wird also eine neue Realität hergestellt, dann lässt sich fragen, welche Qualitäten diese Realität auszeichnet. Ist sie System-konfrom, erneuert sie einfach die dominanten Dynamiken, oder öffnet sie Räume, in dem auch anderes entstehen kann? Wie werden Identitäten der einzelnen Akteure festgeschrieben? Wie ist das Verhältnis zwischen ihnen ausgestattet?
Auf der Ebene der aktuellen kulturellen Praxis ist diese Entwicklung eigentlich schon vielfach vollzogen. Wir können ganz allgemein eine Hinwendung zum Performativen, ein Interesse an neuen Formen der Zusammenarbeit, auch zwischen professionellen und nicht-professionellen Akteuren (in der Architektur etwa in Baugruppen) und Formen der (Wieder)Aneignung (z.b. re-enactments) beobachten.
Was noch teilweise noch fehlt sind die ideologisch-rechtlichen Konsequenzen dieser Verschiebungen. Noch beruhen die rechtlichen Konstruktionen auf der Idee der Urheberschaft und noch stehen überholte Selbstverständnisse von Autoren einer Entmystifizierung von Autorschaft entgegen. Die damit verbundenen Ängste sind aber unbegründet, denn die Betonung von Öffnungen und Verbindungen, von Veränderung und Fortschreiben macht Autorschaft keineswegs obsolet, sondern bettet sie ein in eine offene Kultur der Vielstimmigkeit.
Archithese, 2012, Nr. 4, S. 60ff