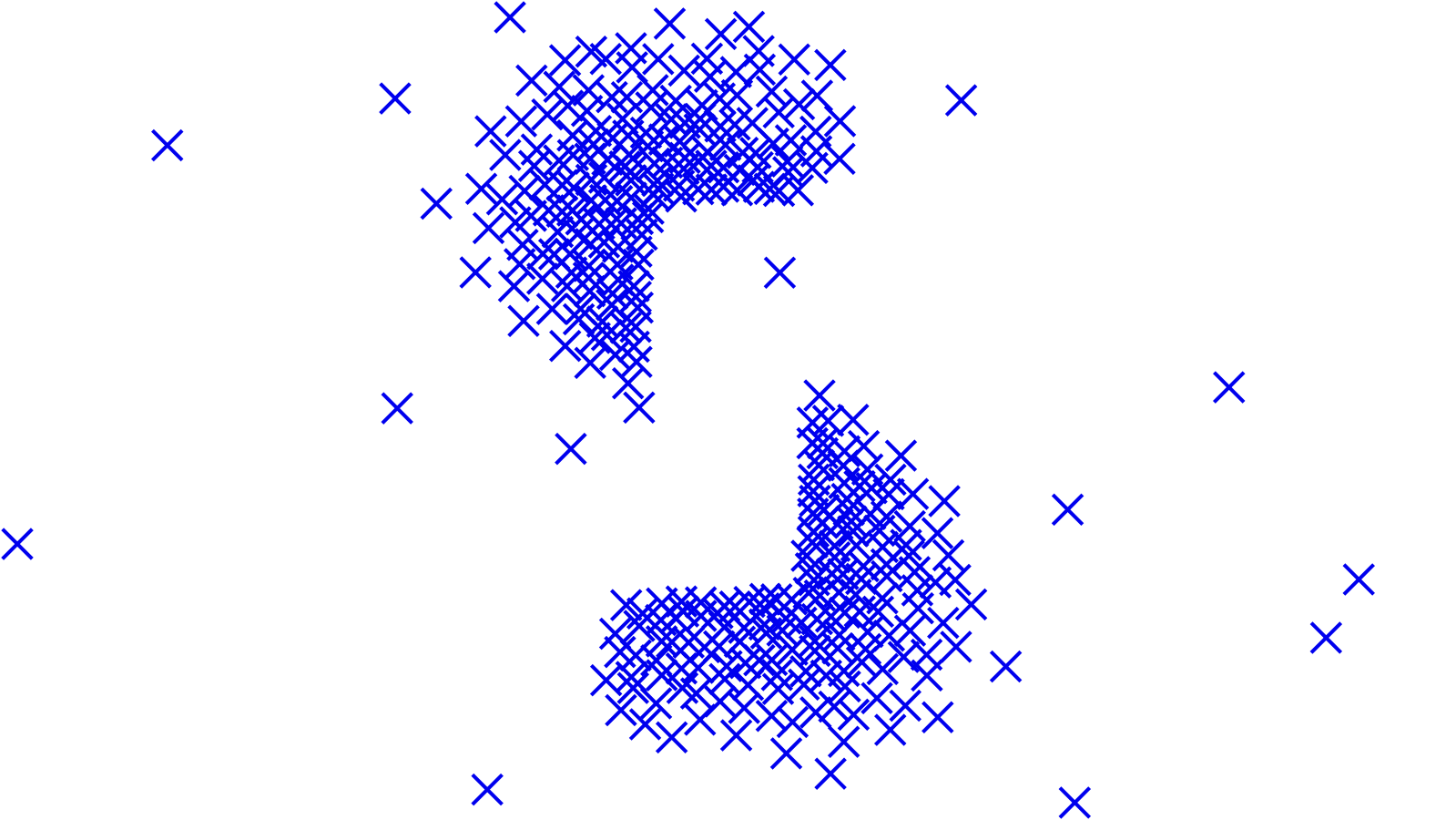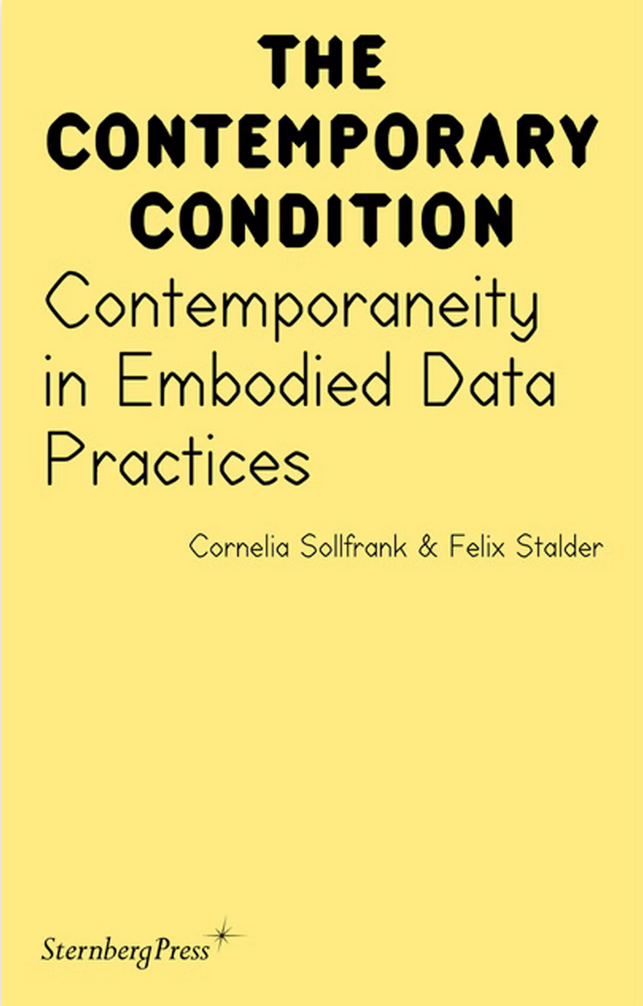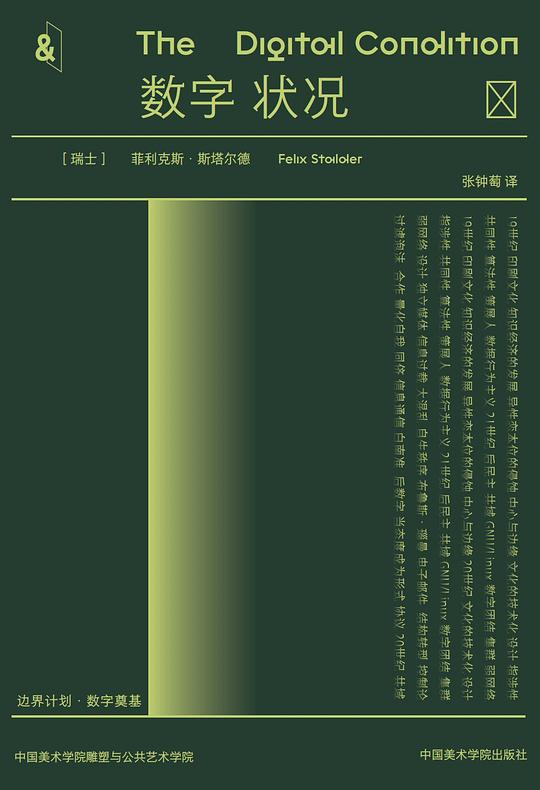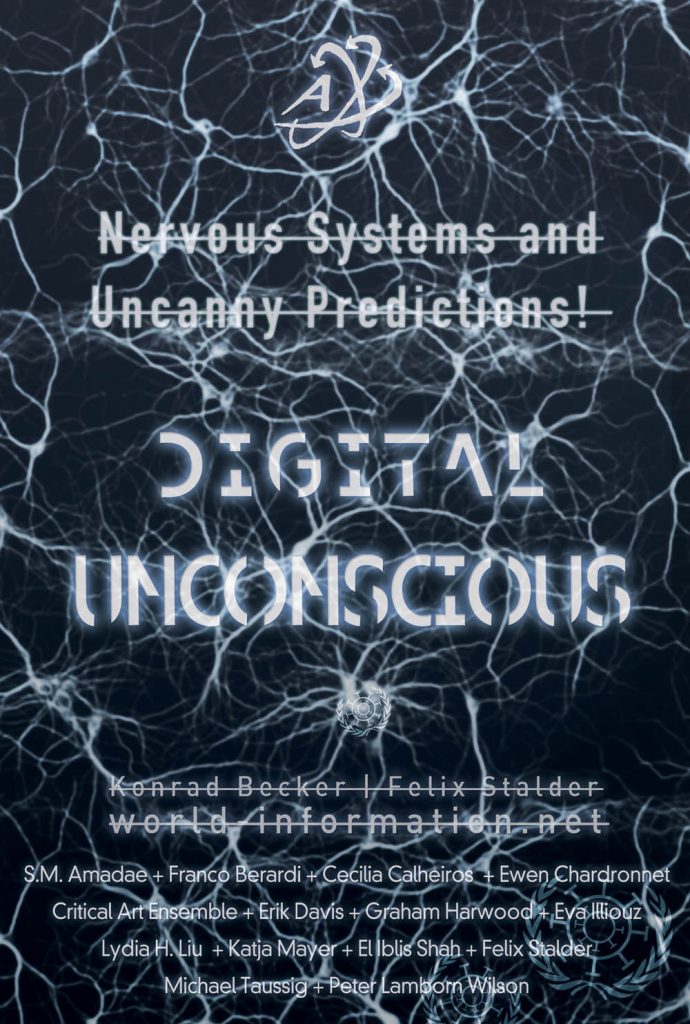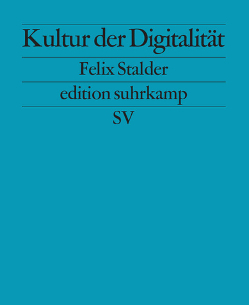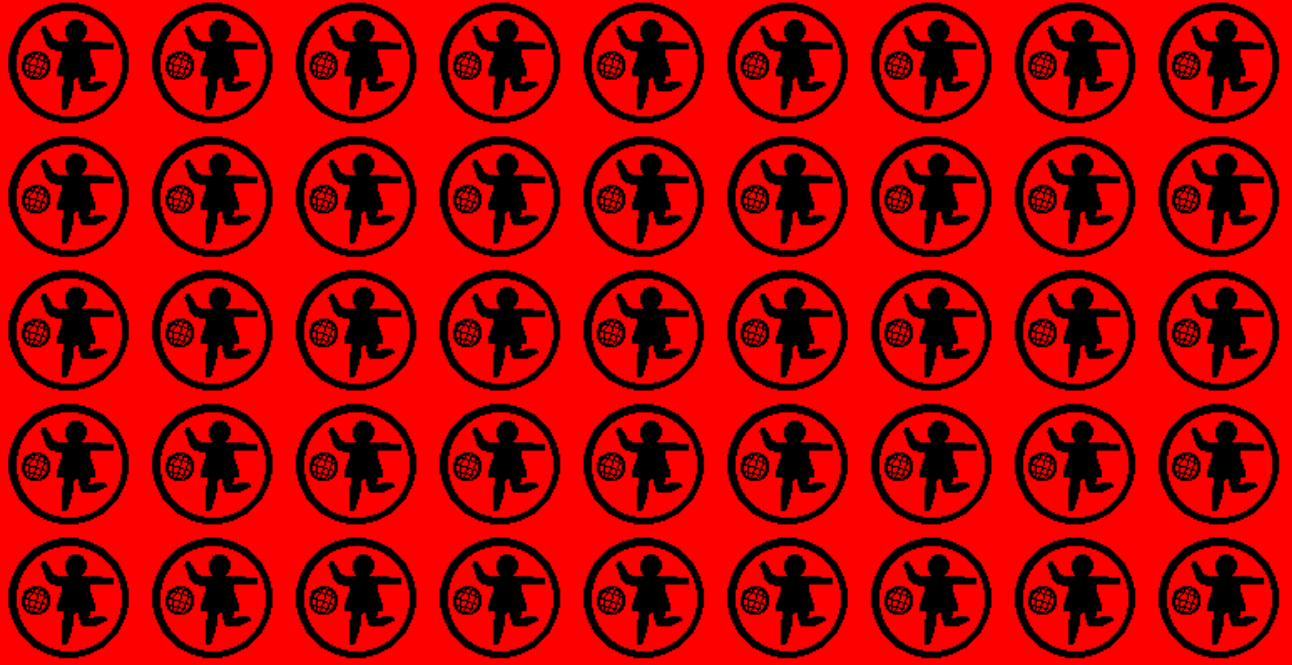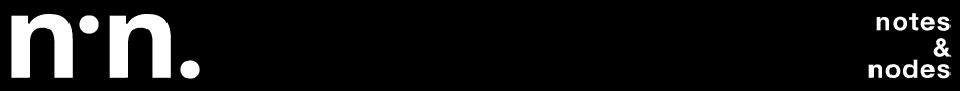
Martin Lätzel: Welchen Stellenwert messen Sie der Digitalisierung in unserem Zeitalter bei?
Felix Stalder: Durch die Digitalisierung ist eine neue Infrastruktur der Wahrnehmung, der Kommunikation und der Koordination entstanden. Weil diese Tätigkeit so grundlegend für fast alle individuellen und kollektiven Tätigkeiten sind, bleibt kaum ein Aspekt unserer Existenz davon unberührt. Das reicht von der Veränderung der Art- und Weise, wie jedeR Einzelne sich selbst erfährt, bis hin zu Fragen, wie wir unsere Demokratie und das Verhältnis zu Natur neu gestalten wollen.
ML: Welchen Kulturbegriff legen Sie Ihren Thesen zugrunde?
Kultur hat für mich eine „soziale Bedeutung“, sie ist ein partieller und fragiler Konsens über Wertefragen. Überall da, wo wir uns entscheiden können und müssen, da kommen kulturelle Fragen auf. Was ist die richtige Ernährungsweise? Welche Eingriffe sollen der pränatalen Medizin erlaubt werden? In Summe stellt und versucht Kultur die Frage zu beantworten: Wie sollen wir leben? Solche Fragen sind immer umstritten, deshalb ist Kultur ein Prozess, der sich in dauernder Veränderung befindet. Das Besondere an Kultur unter den Bedingungen der Digitalität ist, dass sich mehr Menschen, auf mehr Feldern denn je in diese Auseinandersetzungen einmischen. Damit das funktionieren kann, brauchen sie immer komplexere Technologien, die es möglich machen, die enormen Informationsmengen, die dabei entstehen, zu verarbeiten.
ML: Immer öfter hört man den Begriff der „disruptiven“ Entwicklung der Digitalisierung. Ist das aus Ihrer Sicht Alarmismus, oder wie müssen wir diese Disruption verstehen?
Disruption bedeutet zunächst, dass sich die Dinge nicht mehr inkrementell weiterentwickeln, sondern sich grundsätzlich verändern. Dass also alte Muster obsolet werden und neue Muster entstehen, die nicht mehr einfach aus den alten abgeleitet werden können. Die Digitalisierung ist in diesem Sinne sicher in vielen Bereichen disruptiv. Was aber nicht heissen muss, dass wir deshalb existierende zivilisatorische Errungenschaften aufgeben müssen, wie etwa demokratische Teilhabe, sozialen Ausgleich, kollektive Absicherungen etc. Wir müssen uns aber fragen, welche neuen Formen brauchen diese Ziele, damit sie unter veränderten Bedingungen besser funktionieren können.
ML: Was ist für Sie der Kern dessen, was Sie eine „Kultur der Digitalität“ nennen?
Die veränderten Bedingungen der Verhandlung kultureller Fragen – mehr Menschen, mehr Felder, mehr Technologie – haben zu neuen Formen der Orientierung hervorgebracht. Dabei stehen für mich drei neue Formen im Zentrum. Erstens, Referentialität. Das heißt, das Auswählen, Zusammenführen und Verändern von bestehenden Informationen zu neuen Sinn- und Handlungszusammenhängen ist eine grundlegende Tätigkeit für alle geworden. Die sozialen Medien mit ihren Möglichkeiten des „likens“ und des „sharens“ sind genau darauf optimiert. Sie erlauben, Dinge auszuwählen und diese Auswahl mit anderen zu teilen. Dieses Teilen ist zentral, denn Bedeutung kann niemand alleine herstellen, dazu braucht es immer andere, die die eigene Auswahl validieren und erweitern. Deshalb ist der zweite Aspekt jener der Gemeinschaftlichkeit. Es sind Gemeinschaften, wenn auch oft temporär und partiell, die das eigentliche Subjekt der Kultur der Digitalität darstellen. In ihnen werden die Fragen in einem andauernden Gespräch verhandelt und weniger von jedem einzelnen im Rückzug in seine Innerlichkeit. In diesem Sinne ist das bürgerliche Individuum eine Subjektform, dessen historischer Höhepunkt wohl überschritten ist. Der dritte Aspekt ist Algorithmizität. Das heißt, unser Angewiesensein auf intelligente, dynamische Maschinen, die uns ermöglichen, die Welt wahrzunehmen und in ihr zu handeln. Ohne Google oder andere Suchmaschinen (oder im Hintergrund ablaufende Filter, wie bei Facebook) könnten wir die enormen Informationsmengen, in denen wir uns täglich bewegen, nicht bewältigen. Wir wären in einem ganz direkten Sinn blind und handlungsunfähig. Damit kommen aber neue Fragen auf, denn diese Technologien, die uns wahrnehmen, denken und handeln helfen, sind nicht neutral, sondern immer mit gewissen Annahmen, Werturteilen und Zielvorstellungen behaftet. Das ist unumgänglich, nur stellt sich die Frage, wer entscheidet über diese Setzungen, und wie können wir sie demokratisch verhandeln?
ML: Sind staatliche Systeme, ist die Kulturelle Infrastruktur überhaupt, substanziell, strukturell und rechtlich in der Lage, die „Kultur der Digitalität“ sinnvoll für das Gemeinwohl zu gestalten?
Sie müssen es werden, denn wer sonst hat die notwendige demokratische Legitimität? Der Markt alleine wird das nicht richten können. Die Frage ist, welche neuen Werkzeuge brauchen staatliche Systeme, um die kulturellen Ziele: umfassende Bildung für alle, informationelle Grundversorgung, Gemeinschaftliche Identität etc auch unter veränderten Bedingungen zu erreichen? Welche Aufgaben kann der Markt übernehmen, welche die Öffentliche Hand, und welche die neuen Gemeinschaften, die sich selbst organisieren? Die Kulturpolitik ist da eigentlich weiter als andere Felder, weil es hier noch nie um eine reine Staat/Markt Verteilung ging, sondern zivilgesellschaftliche Akteure traditionell eine wichtige Rolle spielen.
ML: Wird die „Kultur der Digitalität“ eine Art akzelerationistische Rolle in der Gesellschaft übernehmen oder führt diese Idee sich insofern ad absurdum, da die technische Entwicklung die Gesellschaft so verändert, dass eine Gemeinwohlorientierung, immaterielle und kulturelle Werte nicht mehr möglich sind?
Die Kultur der Digitalität ist zunächst eine Feststellung der bereits stattgefundenen Veränderungen und der neuen Bedingungen, unter denen weitere Veränderungen ablaufen werden. Das hat mit Akzelerationismus, also mit der Forderung, die Geschwindigkeit der Veränderung soweit zu erhöhen, dass das System in eine Krise gerät und damit grundsätzlich verändert werden kann, nichts zu tun. Dass durch die Digitalisierung die Gemeinwohlorientierung, die in den alten sozialstaatlichen Institutionen organisiert war, in die Krise geraten ist, ist weniger einer Folge des technologischen Wandels als des politischen Wandels und der zunehmenden Dominanz neoliberaler Institutionen, die auf Individualität und Konkurrenz setzen. Die Digitalität ermöglicht auch neue Formen der Solidarität und des horizontalen Miteinanders. Denken sie etwa an die Wikipedia, oder an die Möglichkeiten von Bürgerkraftwerken und Nachhaltiger Energieversorgung, die neue intelligente Stromnetze und Speichertechnologien eröffnen. Durch die Digitalisierung ist der politische Raum nicht kleiner, sondern größer geworden. Alternativlosigkeit gibt es nicht mehr!
ML: Welche Aufgaben haben die Kulturpolitik und die Kulturelle Infrastruktur in der „Kultur der Digitalität“?
Wenn Kultur als Verhandlung sozialer, also geteilter, Bedeutung verstanden wird, dann ist es die Aufgabe der Kulturpolitik, diese Prozesse zu organisieren. Sie sollte Räume, Strukturen und Mittel zu Verfügung stellen, um soziale Bedeutung erfahrbar zu machen, sie zu erneuern und zu verhandeln. Das reicht von traditioneller Repräsentationskultur bis hin zu neuen Formen der kulturellen Teilhabe. Eine wichtige Aufgabe darüber hinaus wird sein, Begegungsräume zu organisieren, in denen unterschiedliche kulturelle Gemeinschaften mit ihren sich immer weiter ausdifferenzierenden Horizonten und Orientierungen treffen können, um das Gemeinsame in ihrer Unterschiedlichkeit neu zu bestimmen.
ML: Welche Tools, welche Instrumente sind notwendig?
Von den Grundformen der Digitalität – Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität – sind die Bedingungen und praktischen der Realitäten der Referentialität am direktesten von kulturellen Institutionen beinflussbar. Sie hängen etwa davon ab, ob und wie die Institutionen ihre (digitalisierten) Materialien zu Verfügung stellen. Der traditionelle Bildungsauftrag zu erfüllen reicht nicht mehr. Das Publikum will Dinge, etwa in Museen, nicht mehr nun anschauen, sondern als (Roh)Material für eigene kulturelle Arbeit nutzen können. Hier stellt sich die Frage nach digitalen Archiven und nach dem Zugang dazu. Ein sehr interessantes Beispiel sind etwa die „Studios“ des Reichsmuseums in Amsterdam, dass hochauflössliche Scan seiner Sammlungsstücke zur freien Nutzung bereitstellt, ohne zu unterscheidne, ob dies eine professionelle/kommerzielle Nutzung ist oder nicht.
ML: Wie sehen Sie die Verbindung zwischen ihrer Systematik einer Kultur der Digitalität und der Analyse einer Gesellschaft der Singularitäten von Reckwitz?
Ich denke, unsere Analysen gehen in eine ähnliche Richtung, für uns beide sind die stete Ausweitung der kulturellen Felder und die Anforderung an jede und jeden Einzelne(n), sich als einzigartigen kulturellen Produzent zu positionieren, wesentliche Elemente der Gegenwart.
Ich sehe das aber auch mit einer gegenteiligen Tendenz verbunden, nämlich der Herstellung von Gemeinschaftlichkeit, in der die kulturellen Differenzierungen überhaupt gelesen und positiv bewertet werden können. Ohne die anderen, die meine „Einzigartigkeit“ verstehen und schätzen, ist diese nichts wert. Und damit sie das können, dürfen sie nicht zu unterschiedlich von mir sein, sondern müssen eine gewisse Zahl von Grundannahmen teilen. Wir haben es also letztlich nicht mit einer, sondern mit drei Bewegungen zu tun. Der Fragmentierung (immer mehr unterschiedliche Nischen), der Homogenisierung (das gemeinschaftliche Element) und dem was Reckwitz die Singularität nennt, also die andauernde Produktion von Differenz im Kontext dieser anderen beiden Bewegungen. Wenn sie nicht Teil einer Gemeinschaft sind, dann stehen die homogenisierenden Aspekte im Vordergrund (Alle Hipster tragen Bärte!), wenn sie Teil der Gemeinschaft sind, steht die Differenzierung in Zentrum.