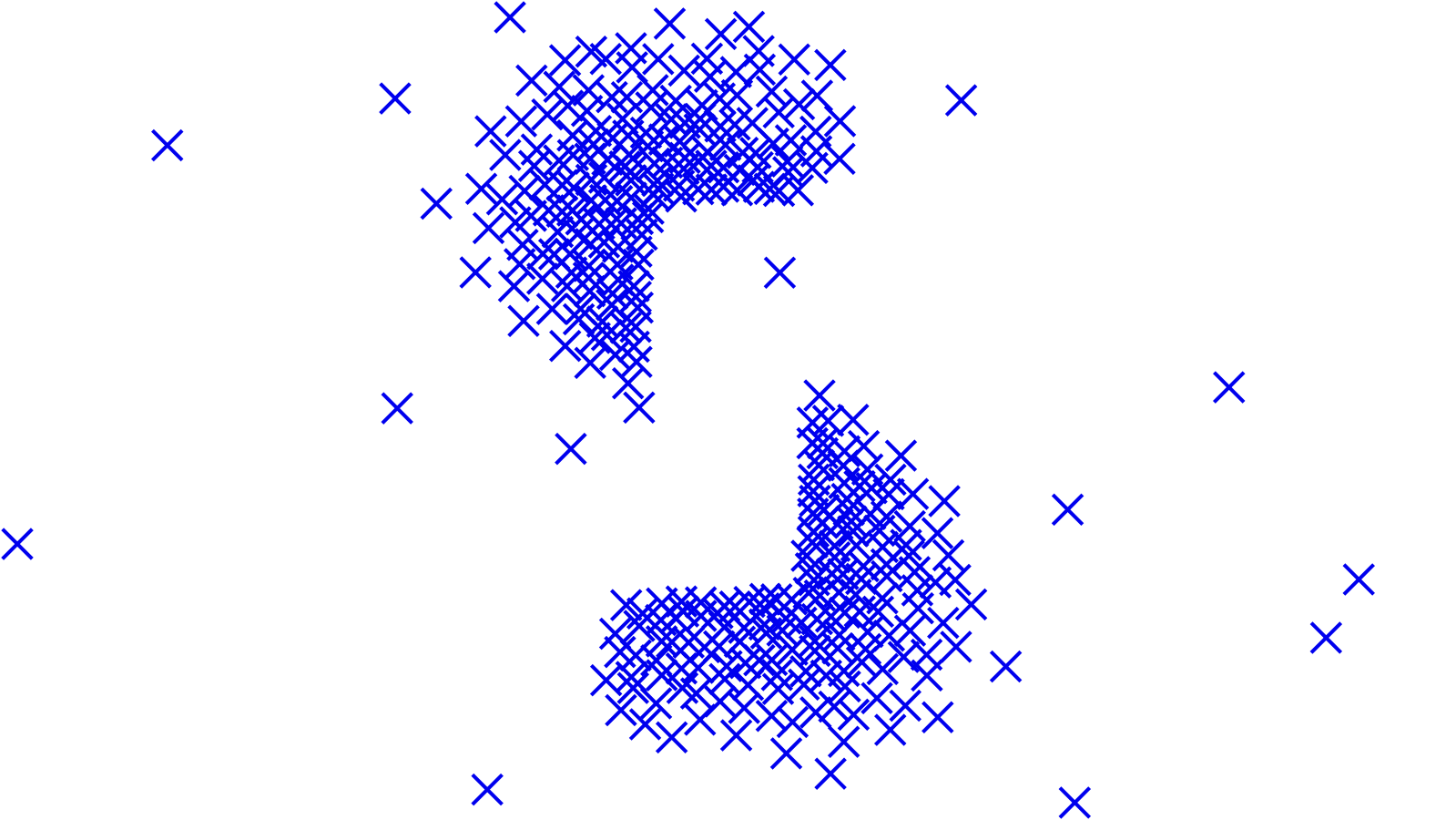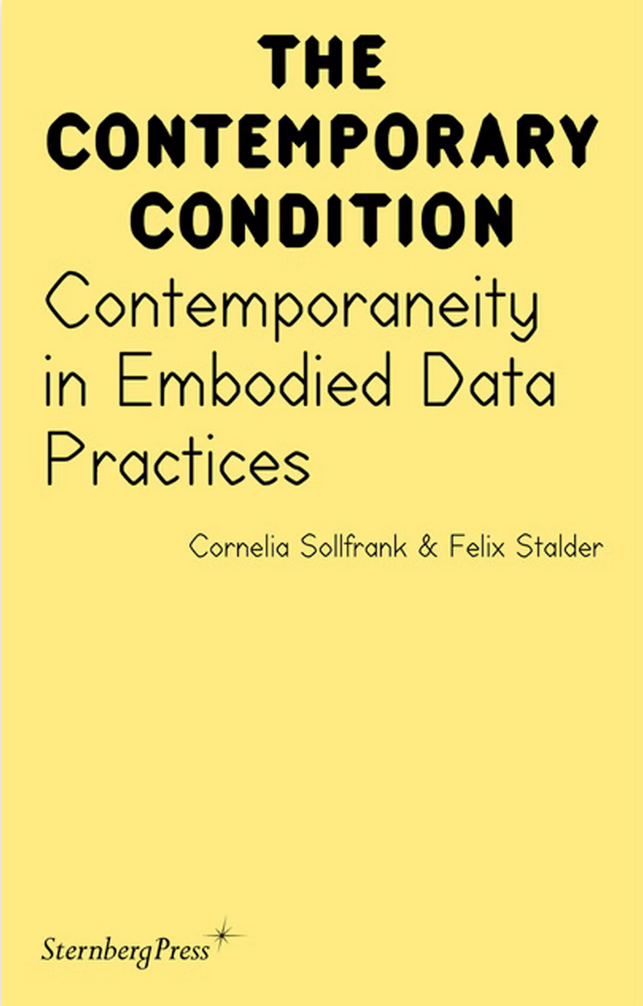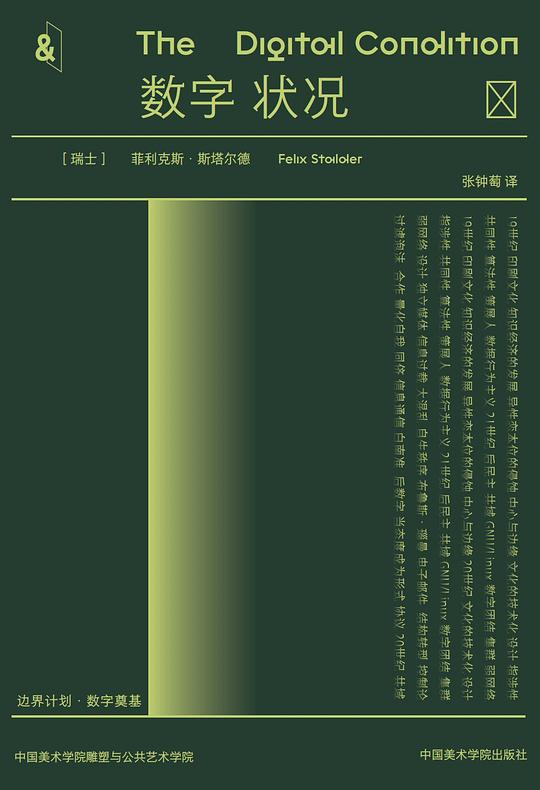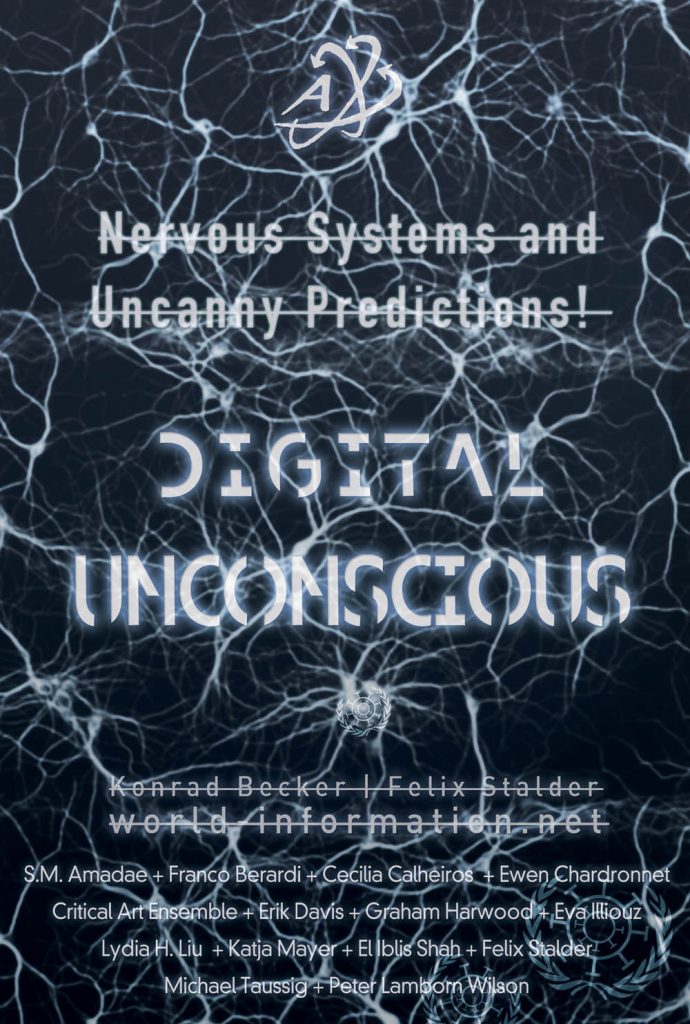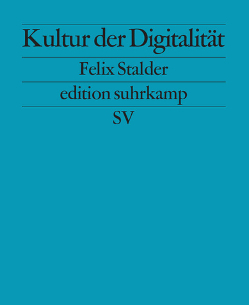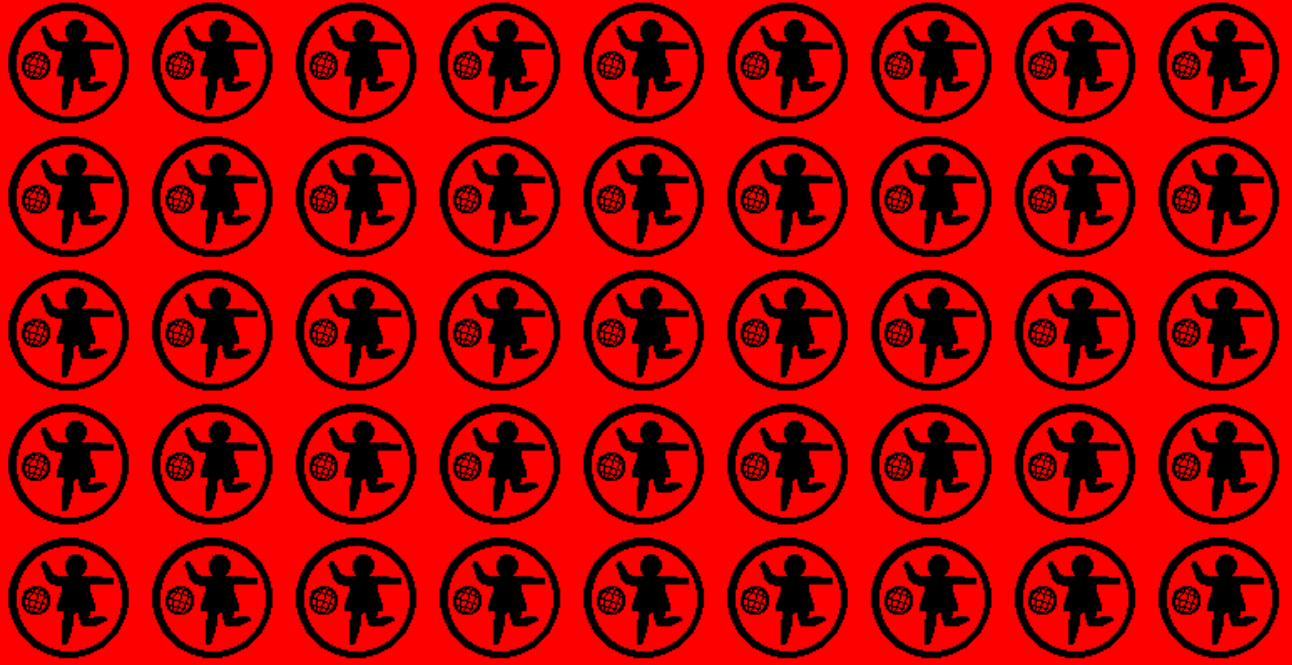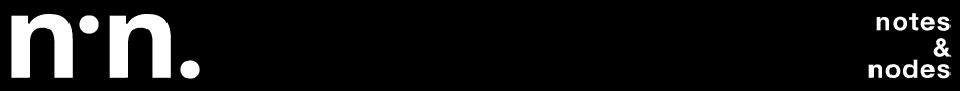
ROLAND SCHAPPERT: Ihr Buch „Kultur der Digitalität“ von 2016 bietet eine sehr gute Grundlage zum Verständnis der digitalen Transformation in unseren westlichen Gesellschaften und den Auswirkungen auf die künstlerische Produktion und kulturelle Vielfalt. Was hat Sie veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
FELIX STALDER: Ich wollte zeigen, dass wir uns in einer umfassenden kulturellen Transformation befinden, also in einer strukturellen Veränderung, wie Menschen sich in der Welt orientieren und dass wir den Kipppunkt schon überschritten haben. Die neuen kulturellen Muster dominieren heute. Dabei war mit wichtig, zu zeigen, dass diese Veränderungen nicht durch die Technologien ausgelöst wurden, sondern dass die Technologien selbst Teil dieses Wandels sind, den sie wiederum vorantreiben. Seit den 1970er Jahren haben wir es mit sich gegenseitig verstärkenden Prozessen zu tun, die diese Veränderungen unumkehrbar machten. Dennoch, das bedeutet nicht, dass es keine politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Alternativen mehr gibt. Die gibt es sehr wohl, nur müssen sie unter den neuen Bedingungen gedacht werden.
Sie beschreiben drei formale Eigenheiten, die Kultur der Digitalität erst verstehbar machen, als eine zusammenhängende Entwicklung und bezeichnen sie mit Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Wenn ich Ihre Untersuchung aus dem Blickwinkel der gegenwärtigen und möglicherweise zukünftigen Kunstproduktion betrachte: Ist das Spannungsfeld der Kunst dann nur noch eine Frage der Bezüge (Stichwort Referenzialismus), der interessegeleiteten Auswahl, der Filtermechanismen und nicht mehr eine Frage der Innovation?
Besonders auf dem kulturellen Gebiet ist Innovation immer ein relativer Begriff. Im Bezug auf was kann etwas als innovativ betrachtet werden? Und genau um diesen Bezugsrahmen wird heute heftiger denn je gerungen, weil jeder Bezugsrahmen immer selektiv ist (und sein muss). Aber wer kann heute diese Selektion betreiben? Da ist zunächst jeder Einzelne, der aus dem Überangebot auswählen muss. Jede einzelne Künstlerin und jeder einzelne Künstler muss für sich entscheiden, welche Kunstgeschichte für sie oder ihn relevant ist. Das geschieht durch aktives Auswählen (Referenzieren). Sinn kann aber nicht von einer einzelnen Person hergestellt werden, sondern muss immer durch andere bestätigt werden, die ihren Anteil zu dieser Auswahl beitragen. Das ist das Gemeinschaftliche. Das sind aber immer nur sehr partielle Unterfangen. Dazu kommen dann neue Versuche, einen Überblick über das Ganze zu verschaffen. Das können aber nur noch Maschinen machen, die Datenmengen sind einfach zu groß geworden. Im Kunstfeld ist dieses Verfahren noch relativ schwach ausgeprägt, weil hier Domainexpertisen (von Kritikern, Kuratoren, Galeristen) noch viel zählen. Aber verschiedene Rankings versuchen dies – und ihr Einfluss, vor allem auf Kunstinvestoren, ist nicht zu unterschätzen. Das seit 2001 existierende Artfacts.net wirbt mit dem Slogan: „Unlock the Art Market. Get real statistics on which artists are trending where now.“
Müssten wir zukünftig eher von einer Gebrauchs- oder gar Verbrauchskunst sprechen, wenn die Nutzung der referentiellen Verfahren wie Remix, Remake, Reenactment, Appropriation, Sampling, Hommage, Zitat, Camouflage, Mashup etc. jede Gestaltung eines noch weitgehend bedeutungsfreien Rohmaterials ersetzen?
Nein, würde ich so nicht sagen. Was wir sehen ist eine neue digitale Volkskultur – im Sinne einer Kultur, in der die Trennung zwischen Produktion und Rezeption schwach ausgeprägt ist (wie etwa im Gesangsverein). Diese entsteht im engen Zusammenhang mit der kommerziellen Kultur des Mainstream, aber kaum im Zusammenhang mit der bildenden Kunst. Letztere bleibt relativ abgeschottet, aber auch sie wird dynamischer und kontextsensitiver, das heißt, sie ist selbst mehr daran beteiligt, den Rahmen, in dem sie an Bedeutung erlangt, mit zu bauen.
Die drei Handlungstypen, mit denen Sie die zeittypische Kulturpraxis der Referentialität beschreiben – Auswählen, Zusammenführen und Verändern –, sind dies auch die Produktionsweisen der zeitgenössischen Kunst, die sich in „Gemeinschaftlichkeit“ mit anderen Subjekten beweisen müssen?
Ja, je weniger der Bedeutungsrahmen einfach vorausgesetzt werden kann, desto mehr muss jede Arbeit sich selbst aktiv verorten und somit an der gemeinschaftlichen Dimension mitarbeiten. Das enthält einerseits ein Freiheitsmoment, weil man den Kontext wechseln kann und anderseits ein konformistisches Element, weil man sich aktiv und positiv in den selbstgewählten Kontext einfügen muss.
Wenn in der Kultur der Digitalität Produktion und Rezeption, Reproduktion und Kreation weitgehend zusammen gedacht werden und dafür keine außergewöhnliche Begabung erforderlich ist, worin besteht dann noch die Funktion des ausdifferenzierten Systems der Kunst?
Das System der Kunst, jenseits seiner wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung, bietet immer noch Möglichkeiten an, spezifische Diskursfelder und Erfahrungsräume aufzumachen. Gerade weil es relativ stark ausdifferenziert ist, und sich eben von anderen Feldern unterscheidet, können Themen und Weltsichten verhandelt werden, die sonst kaum mehr Platz finden. McLuhan sprach von Kunst als „counter-environment“, also als eine Umgebung, in der andere Erfahrungen gemacht werden können, als im Mainstream. Damit das so bleibt, darf sie sich nicht vollständig dem ökonomischen Imperativ unterordnen.
Oftmals bekommt man den Endruck, digitale Kunst beschäftigt sich mehr mit den technischen Errungenschaften und Möglichkeiten als mit künstlerischer Eigenständigkeit und gesellschaftlich relevanten Themen. Der Künstler wird zum exemplarischen User der Programme. Die Technik kickt, die Inhalte beliebig. Wie sehen Sie das?
Das ist eines der Probleme der klassischen Medienkunst, die sich immer mit den neusten Technologien im Medium dieser Technologien beschäftigt. Diese üben, besonders im ersten Moment ihres Auftretens, eine enorme Kraft aus, was eine inhaltliche Beschäftigung schwierig macht. Ich halte die Gegenwartsorientierung der Kunst für sehr wichtig, und Technologien und Infrastrukturen sind ein wesentliches Element unserer Gegenwart. Aber das heißt nicht, dass dies nur in den Medien der Gegenwart geschehen kann. Ganz im Gegenteil, alle Medien können auf der Höhe der Zeit gedacht werden, besonders wenn sie nicht in Isolation, sondern in Verbindung mit anderen Medien gesehen werden.
Wie sortiere und verwalte ich mein Wissen (auch in Bezug auf die aktuelle Kunst), wenn alle Informationen potentiell auf einer Datenbank bereit liegen und jede Suchanfrage eine vorübergehende, neue situative Ordnung generiert?
Zunächst, indem man sich von der Idee eines standpunktlosen Überblicks (eines „view from nowhere“) verabschiedet. Wir sind immer schon mitten drin und unsere Sicht ist partiell und immer an einen Standpunkt gebunden. Von dem muss man ausgehen und sich auf die Suche machen. Zwischen den Objekten, die man dabei findet, muss man Verbindungen etablieren, sie selbst wieder in einen neuen narrativen Bedeutungszusammenhang stellen und diesen gemeinsam mit anderen validieren. Das bleibt immer bis zu einem gewissen Grad subjektiv, aber diese Erkenntnis könnte auch dazu führen, anderen Narrativen mit größerem Interesse zu begegnen. Diese Arbeit kann kein Algorithmus machen.
(Publiziert in: Kunstforum International # 251, Dez 2017-Jan2018, S. 316-17)