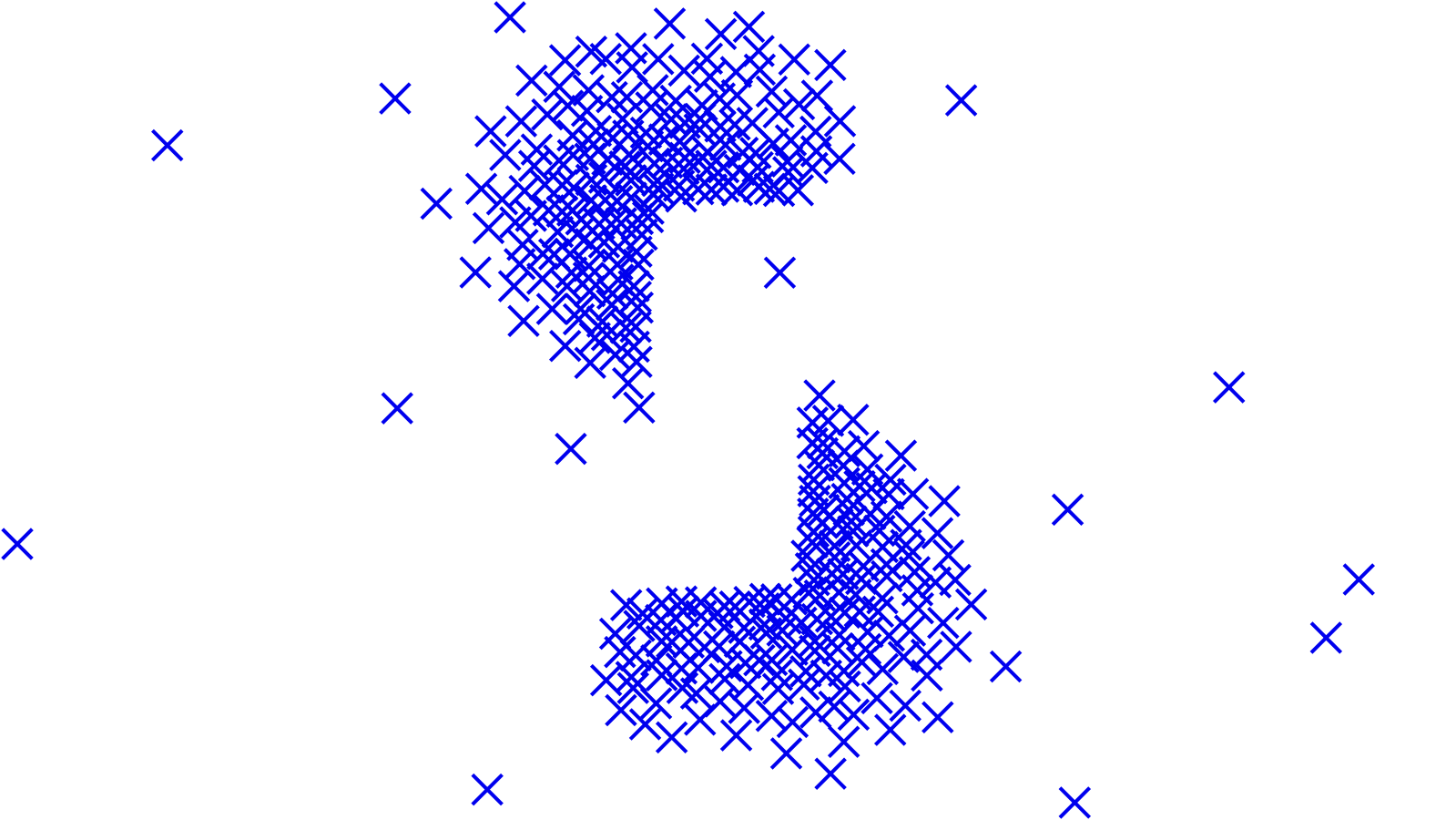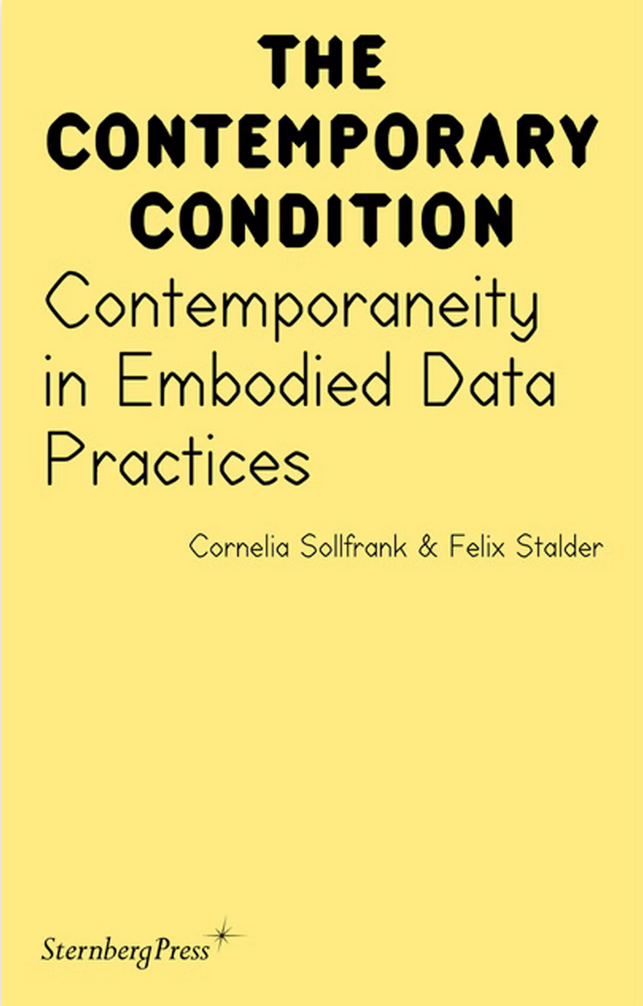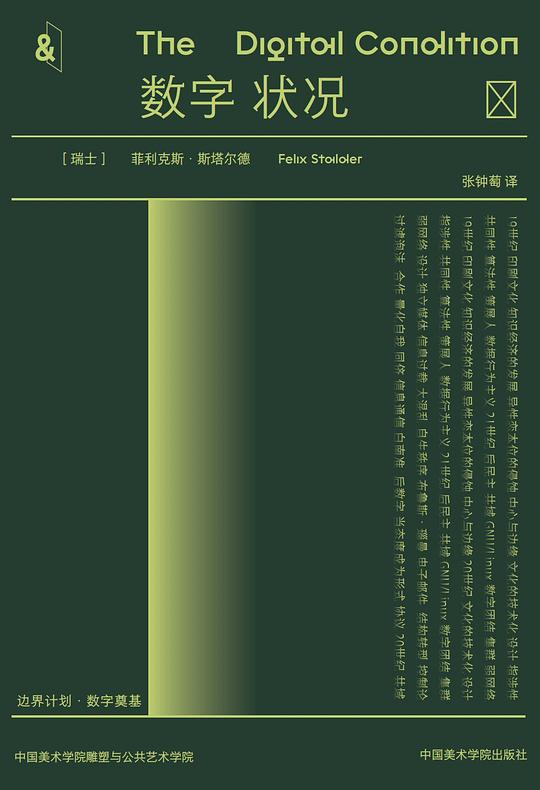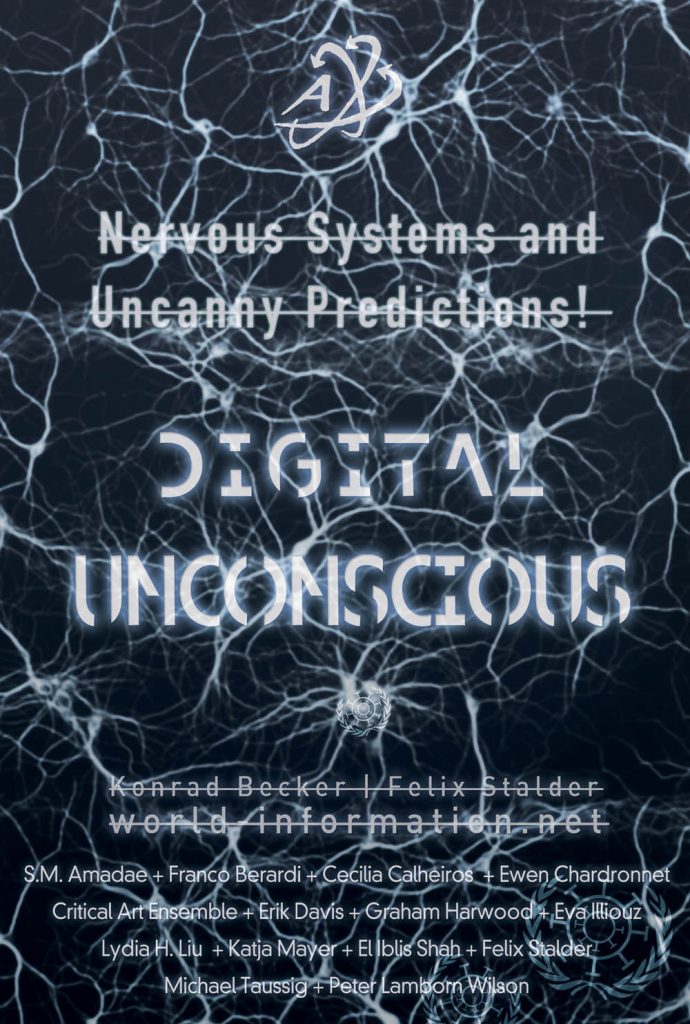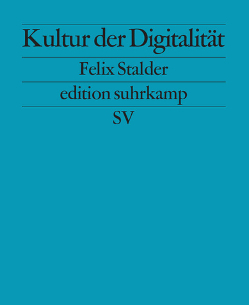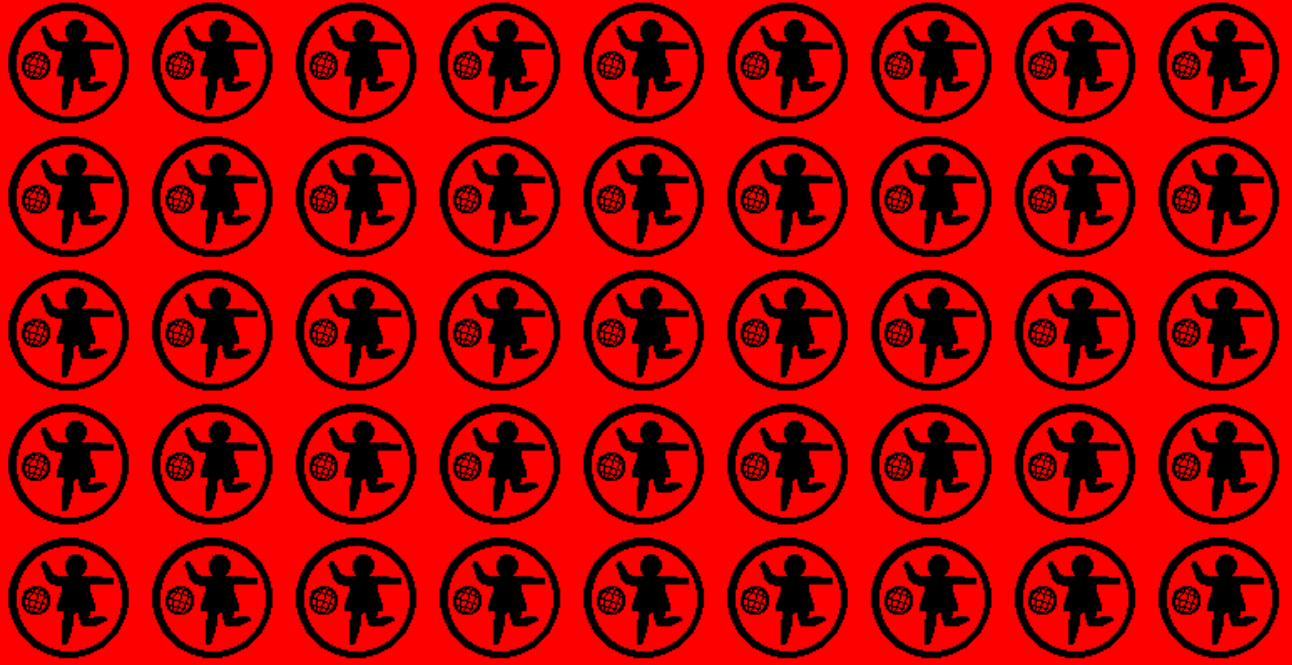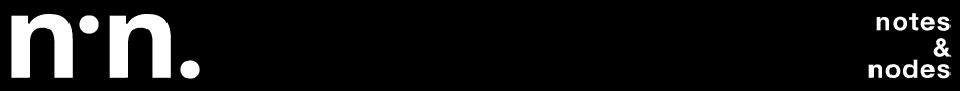
Der Erfolg der Piratenpartei beruht auf dem Wandel der Arbeits- und Lebenserfahrungen. Sie steht für dafür, Partizipation neu zu denken.
Die Feststellung, dass die Piratenpartei eine Protestpartei sei, führt nicht weit. Jede neue Kraft beginnt als Opposition, und der politische „Normalbetrieb“ steckt zu offensichtlich in einer tiefen Krise. Die Entfremdung zwischen BürgerInnen und PolitkerInnen nimmt seit langer Zeit zu. Die alten Transmissionsmechanismen zwischen (Zivil-)Gesellschaft und Politik – die Gewerkschaften, Vereine, Kirchen, Kammern etc. – funktionieren nicht mehr richtig. Entsprechend wird die Politik als abgehoben, von Partikularinteressen manipuliert und in ihren rituellen Appellen zu Wahlkampfzeiten als unglaubwürdig erlebt. Eine wachsende Zahl der BürgerInnen identifiziert sich nicht einmal mehr mit den Parteien, für die sie gerade die Stimme abgeben. Die Zahl der WechselwählerInnen steigt stetig; die Wahlbeteiligung sinkt.
Interessanter ist die Frage, warum der Protest die Form der Piratenpartei angenommen hat.
Nicht unwesentlich dazu beigetragen haben dürfte die Tatsache, dass sich in Deutschland, anders als in den meisten anderen europäischen Ländern, bisher keine rechts-populistische politische Kraft etablieren konnte. Noch wirkt deren Nähe zum rechtsextremen Lager stark stigmatisierend. Die Piratenpartei in Schweden, die bei der Europawahl 2009 noch über 7% der Stimmen erringen konnte, wurde in den Parlamentswahlen im darauf folgenden Jahr von den erstarkten rechts-populistischen, Schwedendemokraten weitgehend verdrängt. Sie erreichte, wie bereits vier Jahre zuvor, nur 0,6%, was wohl etwa dem politischen Gewicht der „Netzthemen“ entsprechen dürfte.
Das Verhältnis zwischen Repräsentation und Partizipation neu denken
Die Piratenpartei profitiert aber nicht nur von der Schwäche der anderen, sie hat auch eigene Stärken. Ihre Kernthemen – freie Kommunikation, Schutz der Privatsphäre, offene Daten, Kritik des Urheberrechts – sind für sich genommen ein relativ schmaler Ausschnitt des gesamten Spektrums, mit dem sich die Politik beschäftigen muss. Aber gemeinsam bilden sie die Grundlage für ein viel wesentlicheres Projekt, für das die Piraten stehen: die Entwicklung neuer Formen der politischen Teilhabe als Antwort auf die schwelende Krise der repräsentativen Demokratie. Wobei sie diese Krise – im Unterschied zum rechten Protest – nicht auf der Ebene der Demokratie, sondern auf der Ebene der Repräsentation ansiedeln.
Die von den Piraten allenthalben ausgerufene Transparenz steht nicht nur dafür, die Staatsapparate und deren Funktionäre kontrollieren zu können – dies war und ist die Funktion von Transparenz in der liberal-bürgerlichen Tradition, zu der sich auch alle anderen Parteien bekennen. Vielmehr dient Transparenz dazu, sich die Daten zu beschaffen, auf deren Grundlage man selbst in die Prozesse eingreifen kann.
Bei aller Apathie den etablierten Parteien gegenüber ist das Interesse, selbst an politischen Prozessen teilzunehmen, heute größer denn je. Das hat zum Einen mit der bereits angesprochenen Krise des politischen Systems zu tun, aber auch mit gesellschaftlichen Veränderungen. Im Berufsleben etwa werden immer mehr eigenständige Kommunikations- und Organisationskompetenzen verlangt. Öffentliches Kommunizieren und kollektives Gestalten, in welcher Form auch immer, ist für die gut-gebildete, junge Mittelschicht, die irgendwo zwischen Prekariat und erfolgreichem Kleinunternehmertum pendelt, tägliches Handeln. Die materielle Grundlage für diese Veränderungen war die Verbreitung der „neuen Medien“. Diese sind für die Generation, die nun politisch aktiv wurde, nicht mehr neu, sondern der Normalfall. Und von diesem Normalfall aus betrachtet ist das politische System geprägt von antiquierten, unglaubwürdigen und entmündigenden Organisationsformen. Die Welt der Generation Internet, wenn man dieses Label brauchen will, ist eine der flexiblen Organisationsformen und der kontinuierlichen, kommunikativen Pflege dieser Formen, sei es auf der privaten Ebene via Facebook, auf der professionellen via LinkedIn oder in sonstigen Foren, Netzwerken und Veranstaltungen, in denen der Kontext für das eigene Handeln hergestellt wird. Durch diese Kontinuität entsteht Involviertheit, Teilhabe und Identifikation.
Das wesentliche Merkmal hierbei ist nicht die Digitalität, sondern die Flexibilität, sowohl was die Organisation, als auch was die persönliche Rolle darin betrifft. Der Grad der eigenen Involviertheit kann und soll variieren. Vereinfacht ausgedrückt, ob jemand „nur“ liest oder auch schreibt, ist im Kontext eines Wikis eine freie Entscheidung, die mal so, mal so getroffen werden kann.
Das Festschreiben dieser Rollen von außen, sei es explizit formal oder implizit durch die in den Organisationsformen selbst angelegten Möglichkeiten und Erfordernisse, wird als Bevormundung empfunden. Und die repräsentative Demokratie ist ein System, in dem die Rollen sehr klar festgeschrieben sind. Entweder AngeordneteR oder WählerIn. Die Möglichkeit zu wechseln besteht nur alle vier Jahre und ein Wechseln stellt eine fundamentale Lebensentscheidung dar, die quasi übergangslos in Kraft tritt. Auch ein Grund, warum sich so viele an ihr Amt klammern.
Liquid Democracy
Dem setzen die Piraten ein Modell entgegen, in dem der und die Einzelne sich flexibel zwischen repräsentativer und direkter Demokratie, zwischen Delegation und Partizipation entscheiden kann. Je nach Thema und Interesse. Die Piraten beschreiben das Grundprinzip in ihrem Wiki folgendermaßen:
„Jeder Bürger kann zu jedem Zeitpunkt für sich selbst entscheiden, wo auf dem Kontinuum zwischen repräsentativer und direkter Demokratie er sich aufhalten möchte. Das bedeutet, dass man beispielsweise jederzeit sagen kann: ‚Beim Thema Urheberrecht möchte ich gerne durch die Piratenpartei, für Umweltpolitik durch die Grünen und für Schulpolitik durch Herrn Müller vertreten werden. Über Studiengebühren möchte ich aber selbst abstimmen.’“
Die Idee dahinter ist die der gewichteten Stimme. Eine Person, die viele andere vertritt, hat mehr Gewicht als eine, die nur wenige vertritt und am wenigsten Gewicht hat der/diejenige, der/die sich selbst vertritt. Auch die klassische, parlamentarische Demokratie kennt die Idee der Gewichtung, praktiziert sie aber sehr ungenau und statisch. Laut Bundeswahlgesetz soll seit der Bundestagswahl 2002 die Größte eines Wahlkreises nicht mehr als +/- 15% vom Durchschnitt abweichen (in Ausnahmefällen ist eine Abweichung von bis zu +/- 25% gestattet). Aufgrund dieser relativen Gleichheit wird dann jeder Stimme der Abgeordneten gleich gewichtet: einE AbgeordneteR, eine Stimme. Verändert sich die Bevölkerungsstruktur, kann die Verteilung und Dimension der Wahlkreise angepasst werden.
In der Vision der Piratenpartei soll nun diese Gewichtung in zweierlei Hinsicht flexibilisiert werden. Zum einem soll man die Stimme nicht nur einem/einer KandidatIn geben können, sondern man kann sie je nach Anlass vergeben. Damit wird der Zwang aufgehoben, eine Partei oder eine Vertretung als ganzes zu wählen, wenn man nur mit einem Teil des Programms einverstanden ist. Dies soll der Entwicklung Rechnung tragen, dass die Gesellschaft nicht mehr durch relativ kohärente Großmillieus (Arbeiterschicht, Bürgertum, etc.), die umfassende Lebensentwürfe bereitstellen, geprägt ist, sondern durch Zersplitterung und Patchwork-Ideologien. Die zweite Form der Flexibilisierung betrifft den Grad der Delegation. Man kann eine Stimme jederzeit zurücknehmen und jemand anderem übertragen – oder sie selbst wahrnehmen. In diesem flüssigen System ist es nun eine Frage der individuellen Interesses, ob man sich, wie bisher, einfach von einer Person/Partei in allen Fragen vertreten lässt und alle vier Jahre einmal zur Urne geht, oder ob man sich sehr viel stärker involviert.
Moderne Kommunikationsplattformen machen es möglich, die dazu notwendige Informationsmenge zu organisieren und jedem/jeder den Detailgrad sichtbar zu machen, den er/sie sich erwünscht. Es gibt bereits viele solche Systeme. Bei Wikipedia etwa kann man einfach etwas nachschlagen, oder man kann tief ins System eindringen und nachvollziehen, wie eine Entscheidung zu Stande gekommen ist. Man kann sich entsprechend gar nicht, nur punktuell oder sehr umfassend engagieren. Die dazu notwendige Informationsmenge ist leicht abrufbar, ohne dass sie aber den/die eilige NutzerIn ablenkt.
Herausforderungen der Realität
So weit die Vision. Die Implementierung ist natürlich eine ganz andere Frage. Gerade die Technologie-affinen Piraten sind sich bewusst, dass die Konstruktion einer Plattform, über die sich solche Prozesse abwickeln lassen, eine extrem komplexe Aufgabe ist. Ob sie im Großen überhaupt bewältigbar ist, ist fraglich. Dennoch, es wird daran gearbeitet und die aktuelle Satzung der Berliner Piratenpartei (Stand 28.2.2010) vermerkt folgende Punkte:
„ Die Piratenpartei Deutschland Berlin nutzt zur Willensbildung über das Internet eine geeignete Software. Diese muss die ‚Anforderungen für den Liquid Democracy Systembetrieb’ erfüllen, welche vom Vorstand beschlossen werden. Die Mindestanforderungen sind:
a) Jedes Mitglied muss die Möglichkeit haben, Anträge im System zu stellen. Zulassungsquoren und Antragskontingente sind zulässig, müssen jedoch für alle Mitglieder gleich sein.
b) Das System muss ohne Moderatoren auskommen.
(...)
f) Es muss möglich sein, die eigene Stimme mindestens themenbereichsbezogen durch Delegation an ein anderes Mitglied zu übertragen. Diese Delegationen müssen jederzeit widerrufbar sein und übertragenes Stimmgewicht muss weiter übertragen werden können. Selbstgenutztes Stimmgewicht darf nicht weiter übertragen werden.“
Dieses Verfahren wird innerhalb der Partei rege genutzt, Beschlüsse werden auf diese Art und Weise gefällt bzw. vorbereitet. Jenseits der Frage, ob es auch auf größerer Ebene funktioniert, stellen sich bereits hier zwei Probleme. Zum Einen ist es fraglich, ob sich der enorme Arbeitsaufwand, den ein solches System produziert, mittel- bis langfristig bewältigen lässt. Problematischer ist der zweite Punkt. Solche Systeme und die darin encodierten Regeln, Verhaltensweisen und Sprachstile sind selbst kulturelle Produkte, und als solche haben sie die Tendenz, diejenigen auszuschließen, die diese Kultur nicht teilen.
Die Folge davon kann sein, dass auch ein System, das formal völlig offen ist, sich de facto als äußerst geschlossen erweist. Aus der Community wird unter der Hand ein Club. Dies ist in Internet-basierten Gemeinschaften ein endemisches Problem. Weil diese Gemeinschaften primär durch eine geteilte Kultur zusammengehalten werden – und nicht etwa durch das gemeinsame Nutzen eines physischen Raums – neigen sie stark zu interner Homogenität. Es tut sich dann ein Graben auf, zwischen denen „innen“, die sich als die Einzigen sehen, die arbeiten, und denjenigen „außen“, die den Eindruck haben, mit ihren Anliegen nicht durchdringen zu können und deshalb frustriert aufgeben. Wikipedia kämpft stark mit diesem Problem und ebenso die Piratenpartei, der es etwa kaum gelingt, Frauen einzubinden. Unter den 15 Abgeordneten, die in den Berliner Landtag einziehen, ist nur eine Frau. Eine Quote wie aus dem 19. Jahrhundert.
Nur nicht erwachsen werden
Die große Herausforderung für die Piratenpartei ist es nicht, zu einer „erwachsenen Partei“ zu werden. Dann würden sie ununterscheidbar zu den Grünen oder der SPD. Die Herausforderung besteht darin, gleichzeitig in einem repräsentativen System zu funktionieren und aktiv über es hinaus zu agieren. Auf diesem Weg gibt es viele Fallgruben. Den Grünen, die vor 30 Jahren mit einem ähnlichen Anspruch angetreten waren, sind weitgehend gescheitert und haben sich still und leise von diesem Teil ihrer Geschichte verabschiedet. Die Linkspartei hat dies erst gar nie versucht. Ob die Piraten auf dieser Ebene mehr Erfolg haben werden, wird sich erst zeigen. Angesichts der strukturellen Krise der repräsentativen Demokratie muss man es allerdings hoffen.
Dieser Text wurde verfasst für Analyse & Kritik, Jg. 41, Nr. 565. 21.10.201, S.3 http://www.akweb.de/ak_s/ak565/09.htm