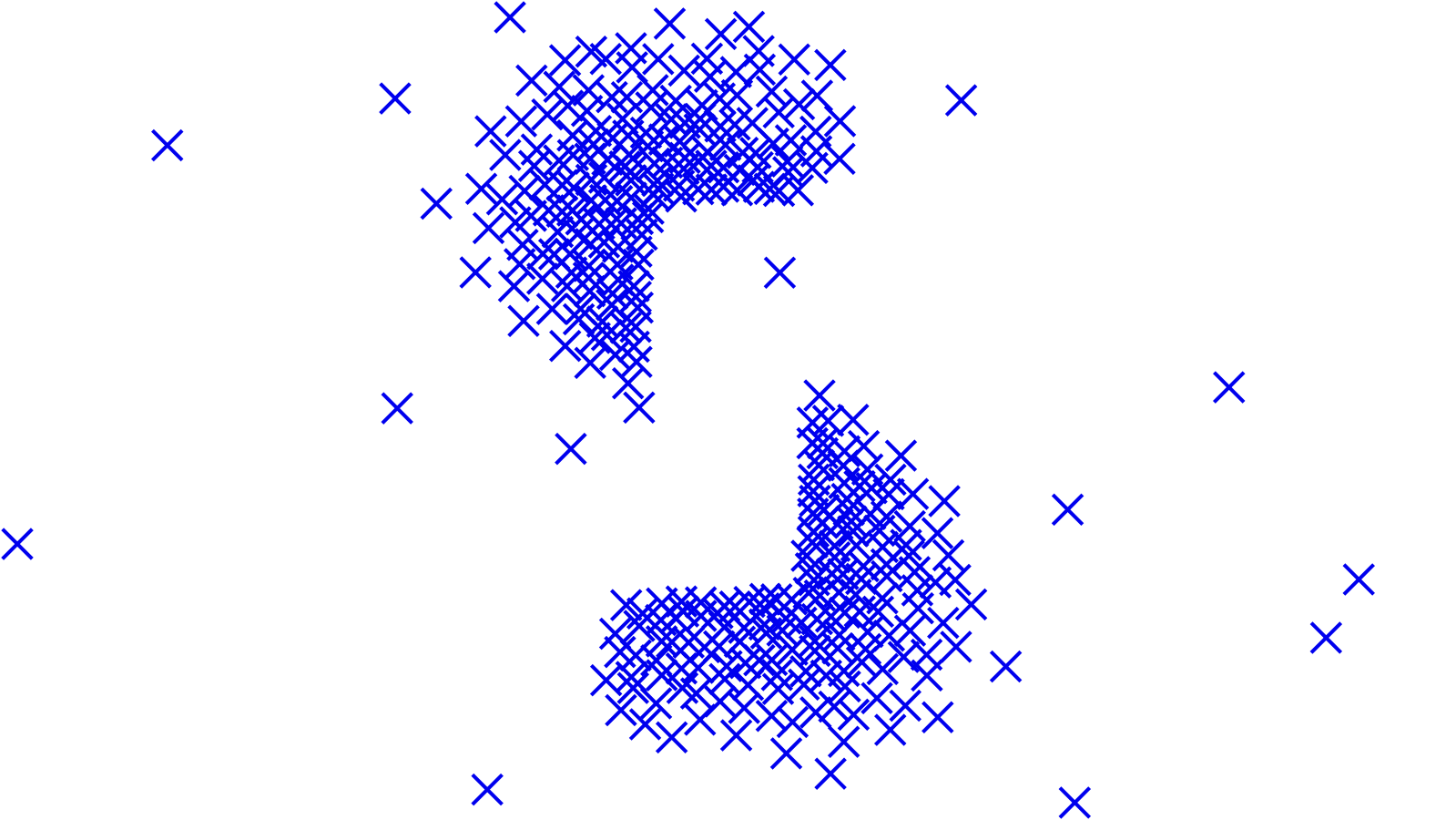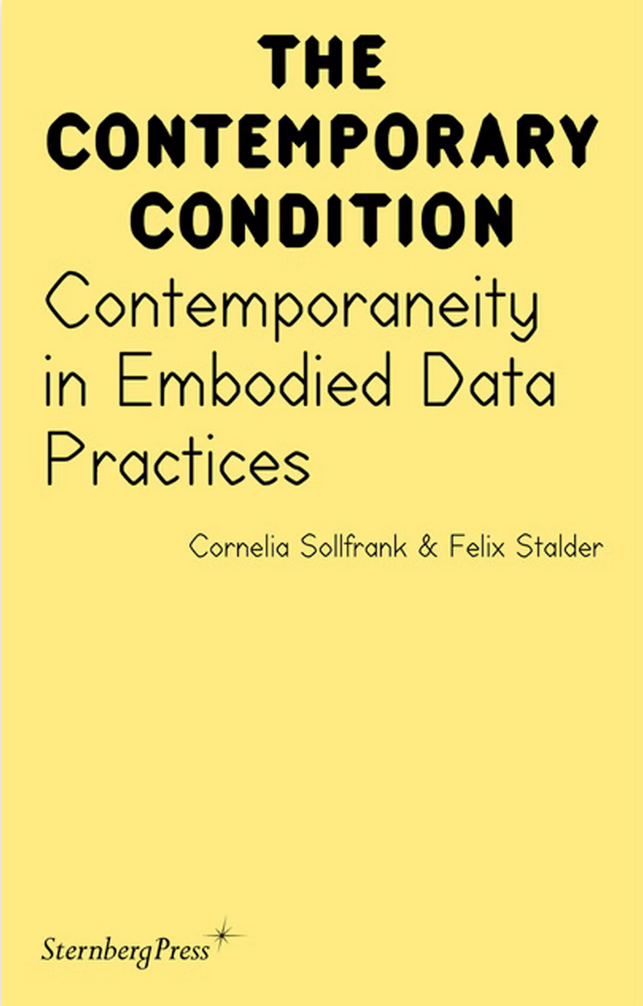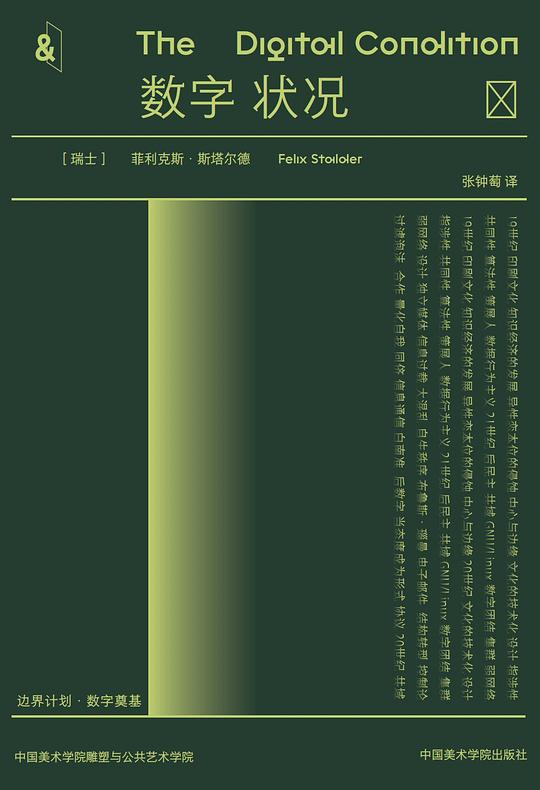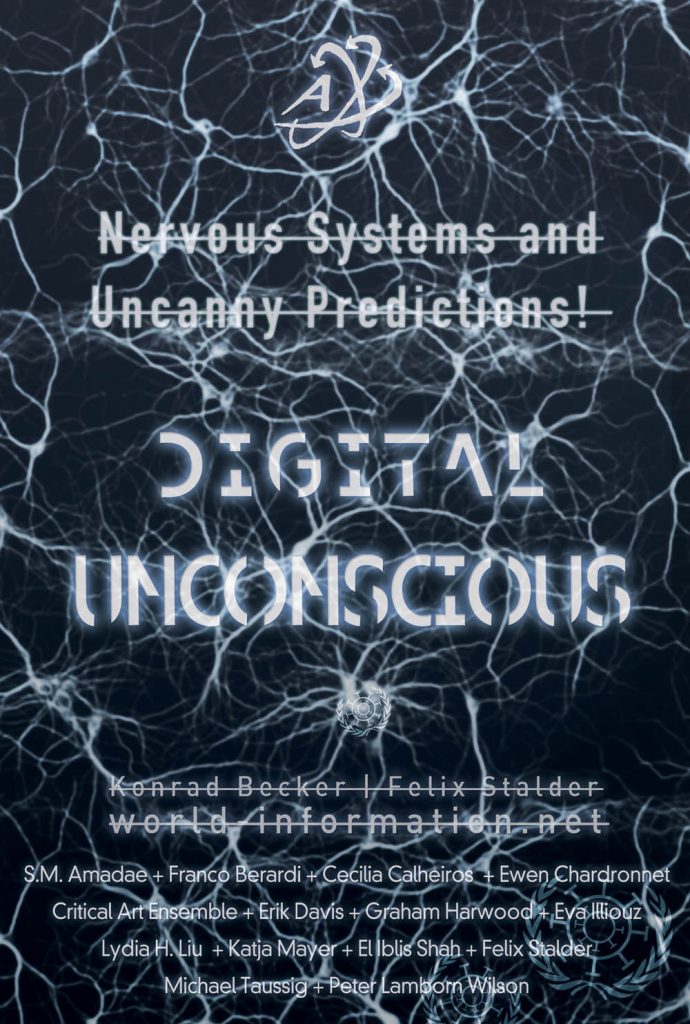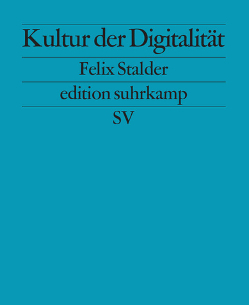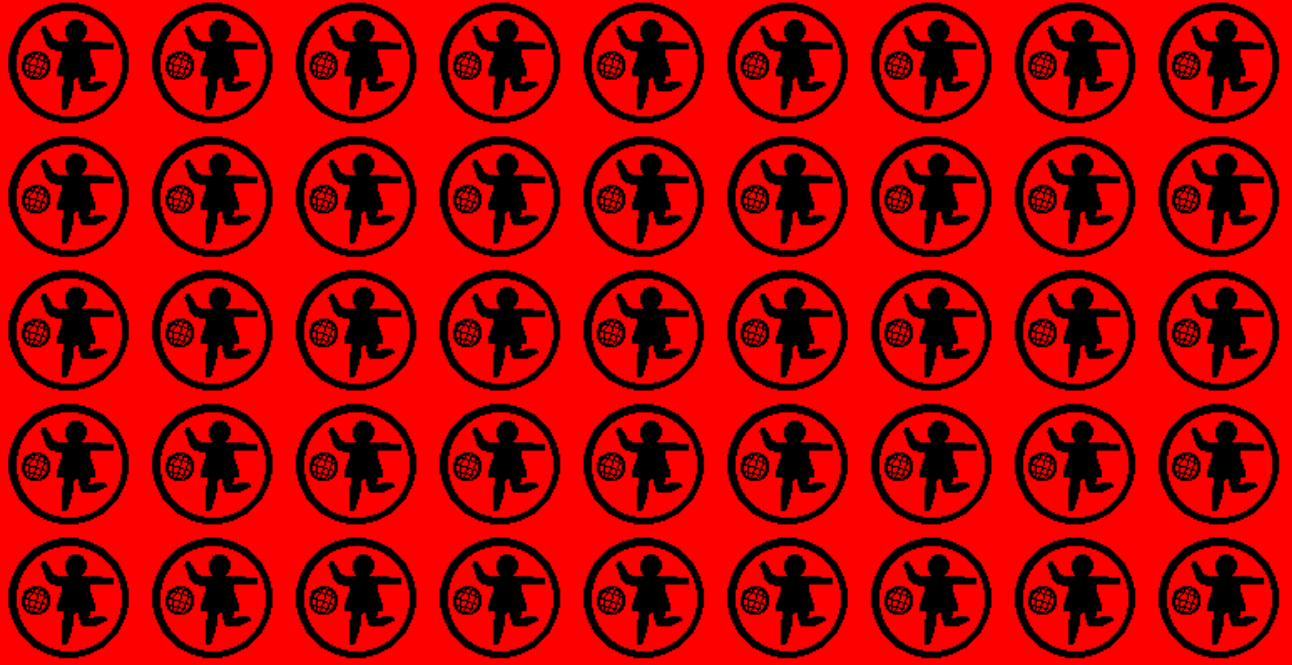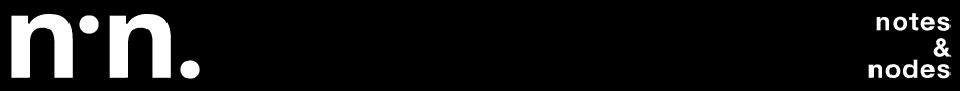
 Google verdient mit unseren E-Mails und Suchanfragen Milliarden. Können wir bald mitkassieren? Felix Stalder, Professor für digitale Kultur, hält das für eine dumme Idee. Interview: Peter Johannes Meier Quelle: Beobachter.ch (13/2014)
Google verdient mit unseren E-Mails und Suchanfragen Milliarden. Können wir bald mitkassieren? Felix Stalder, Professor für digitale Kultur, hält das für eine dumme Idee. Interview: Peter Johannes Meier Quelle: Beobachter.ch (13/2014)
Beobachter: Google wertet permanent aus, was uns im Internet interessiert. Mit unseren Profilen verdient das Unternehmen Milliarden, vor allem durch Werbung, die auf jeden Nutzer zugeschnitten wird. Wir sollten künftig Geld für unsere wertvollen Daten verlangen, fordert der Internetphilosoph und Microsoft-Berater Jaron Lanier. Das klingt verlockend…
Felix Stalder: ...ist aber Unsinn. Soziale Kommunikation und die damit verbundenen Daten haben nicht einfach einen ökonomischen Wert. Privatheit ist eine kulturelle Errungenschaft, ein Bürgerrecht, das man nicht einfach so verscherbeln kann. Sonst könnten wir ja auch unser Stimmrecht dem Meistbietenden verkaufen.
Heute treten die meisten Nutzer ihre Daten praktisch gratis an Firmen wie Google oder Facebook ab. Wäre es nicht zumindest ein bisschen gerechter, wenn sie dafür etwas Geld erhielten?
Es ist ein weiterer Denkfehler, anzunehmen, die Daten eines Einzelnen seien sehr viel wert. Nehmen wir zum Beispiel den beliebten Nachrichtendienst WhatsApp. Facebook hat das Unternehmen Anfang 2014 für 19 Milliarden Dollar gekauft. Der Dienst hatte damals rund 450 Millionen Nutzer. Gäbe man nun die Hälfte des Preises an die Nutzer weiter, hiesse das, dass die Daten einer einzelnen Person gerade mal 20 Dollar wert sind. Wenn man jetzt den Wert noch auf eine einzelne Whats- App-Nachricht herunterrechnet, ist man im Bereich von Mikrobeträgen, die auch zusammengezählt nicht viel einbringen. Die Idee ist keine Antwort auf das eigentliche Problem: die Machtkonzentration bei wenigen Unternehmen wie Google, Facebook oder Apple.
Bis vor wenigen Jahren waren es bloss Datenschützer und Netzaktivisten, die vor der Macht der Datensammler gewarnt haben. Inzwischen fühlen sich auch Medienkonzerne, Marketingoder Reiseunternehmen bedroht. Was ist geschehen?
Bei einem Marktanteil von über 90 Prozent führt kein Weg mehr an der Suchmaschine Google vorbei. Vor allem wenn man etwas übers Internet verkaufen will. Nach welchen Kriterien Google die Informationen bei einer Suchanfrage ordnet, ist aber sehr intransparent. Früher – Google war zu Beginn werbefrei – waren die Verlinkungen der Informationen für ein Suchergebnis entscheidend. Was oft verlinkt wurde, galt als wichtig, also erschien es bei den Resultaten an prominenter Stelle. Über die Jahre sind ständig weitere Kriterien dazugekommen, die das Ranking beeinflussen. Wer fragt? Wo befindet sich die Person? Wofür hat sie sich in der Vergangenheit interessiert? Google weiss nicht nur immer mehr über das Internet, sondern auch über die Menschen, die es nutzen. Google trifft immer mehr Annahmen über uns und unsere Interessen. Das erhöht den Einfluss von Google gewaltig.
Davon profitieren auch Dritte, die für ihre Produkte oder Informationen ein Publikum suchen, das sich auch dafür interessiert.
Ja, aber jetzt kommt hinzu, dass Google nicht mehr einfach den Zugang zu Informationen im Internet bewirtschaftet, sondern selber zum Anbieter von immer mehr Diensten geworden ist: Karten, Wetter, Hotels und mehr. Da die meisten Nutzer nur die ersten paar Suchresultate beachten, hat Google einen immensen Einfluss auf das, was wir wahrnehmen und dadurch vielleicht auch tun. Zudem wird Google zu einem immer bedeutenderen Verkäufer von personalisierter Onlinewerbung auf Seiten Dritter. Dadurch geraten Unternehmen gleich in eine doppelte Abhängigkeit.
Warum gelingt es anderen Suchmaschinen nicht, die Vormacht von Google zu brechen?
Eine Suchmaschine besteht aus einem Index über möglichst viele Informationen im Internet. Das ist mit viel Geld auch für andere machbar. Das Problem sind die Nutzerdaten, mit denen personalisierte Ergebnisse und Werbung möglich werden. Hier hat Google einen immensen Vorsprung, der für andere kaum einzuholen ist.
Der Bessere gewinnt. Muss man Googles monopolartige Stellung einfach akzeptieren?
Nein. Der Zugang zu Informationen im Internet ist von grossem öffentlichem Interesse. Darum ist es auch legitim, gewisse Regeln aufzustellen. In der Vergangenheit sind ähnliche Kartelle sogar zerschlagen worden, auch in den USA. So musste sich Anfang der achtziger Jahre der Telekommunikationskonzern AT&T in sieben unabhängige Firmen aufteilen. Der Vergleich hinkt aber etwas, denn Googles Hauptkapital ist eine Datensammlung, die aus unterschiedlichsten Dienstleistungen gespeist wird. Derart integrierte Daten sind schwierig zu entbündeln. Kartellverfahren gegen Google haben bisher mit Vergleichen geendet, also mit gewissen Zugeständnissen.
Was müsste man Google denn tatsächlich abringen?
Für die Suchmaschine muss man Transparenz einfordern über die Kriterien des Rankings. Es geht um Minimalstandards, die den Algorithmus von Google betreffen. Ein Algorithmus ist ja eine Serie von Wertungen, hinter denen letztlich Entscheidungen stehen, zum Beispiel dass Popularität wichtig ist. Die zentralen Kriterien müssen offengelegt werden. Nicht alle Formen des Rankings sind legitim. Für andere gesellschaftliche Bereiche kennen wir das auch. So darf Religionszugehörigkeit bei einer Stellenbewerbung keine Rolle spielen. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt: offene Standards. Heute ist es selbstverständlich, dass ich meinen E-Mail-Anbieter wechseln und die alten Adressen übernehmen kann. Denn E-Mail ist ein offener Standard. Dagegen ist es nicht möglich, beim Wechsel von Google+ zu Facebook noch mit den alten Freunden in Kontakt zu treten. Das sind geschlossene Standards, die Abhängigkeiten schaffen. Von denen muss man die Nutzer befreien. Indem Google die Suchergebnisse immer mehr auf die Vorlieben eines einzelnen Nutzers abstimmt, manipuliert die Firma immer stärker dessen Wahrnehmung.
Müsste man diesen Filter zur Personalisierung abschalten?
Personalisierte Ergebnisse sind nichts Verwerfliches. Eine Suchmaschine schlägt mir unter Millionen von Ergebnissen diejenigen vor, die mich am ehesten interessieren könnten. Das ist ein wertvolles Angebot. Ich muss es aber auch ausschlagen können. Es fehlt eine einfache Möglichkeit den Personalisierungsfilter bei der Suche auszuschalten.
Im Mai hat der Europäische Gerichtshof Google verpflichtet, Verlinkungen zu Webseiten zu löschen, wenn diese heikle persönliche Daten enthalten. Sie würden bei einer Suchabfrage nicht mehr erscheinen. Ist das als Erfolg für die Nutzer zu werten?
Für den einzelnen Betroffenen wahrscheinlich schon. Weil Google aber selber entscheiden wird, ob Verlinkungen aufgehoben werden, bedeutet das noch mehr Macht für das Unternehmen. Es wird zu einem privaten Rechtsdurchsetzer. Und Google dürfte ein Interesse daran haben, die Fälle möglichst schlank zu erledigen, könnte also auch Druckversuchen erliegen oder falsche Behauptungen nicht erkennen. Normale Nutzer werden von einer Löschung aber kaum etwas erfahren. Sie werden das im Internet immer noch vorhandene Dokument einfach nicht mehr finden. Für solche «Löschungsentscheide» sollte darum ein System von Ombudsstellen geschaffen werden, die von Google unabhängig sind. Google kann nicht seine eigenen und die Interessen der Öffentlichkeit vertreten und gleichzeitig Richter sein. Um fair zu sein: Google hat diese Situation nicht gesucht, sondern ein schlechtes Gerichtsurteil hat diese geschaffen.
Wie gehen Sie vor, damit Sie im Internet nicht allzu viele persönliche Daten hinterlassen?
Ich nutze viele Dienste. Ausser Facebook, das ich für wirklich bösartig halte. Und ich melde mich nicht gleich bei jedem neuen Dienst an und füttere ihn mit Daten. Aber die Realität ist doch, dass wir alle sehr viel preisgeben, weil wir auf nützliche Dienste nicht verzichten wollen. Man könnte jetzt lange über individuelle Sicherheitsmassnahmen im Internet dozieren. Aber wir haben ein strukturelles Problem. Wenn mich im Strassenverkehr ein Auto mit Tempo 200 abschiesst, reden wir ja auch nicht über bessere Sicherheitsgurte, sondern über strengere Geschwindigkeitslimiten.