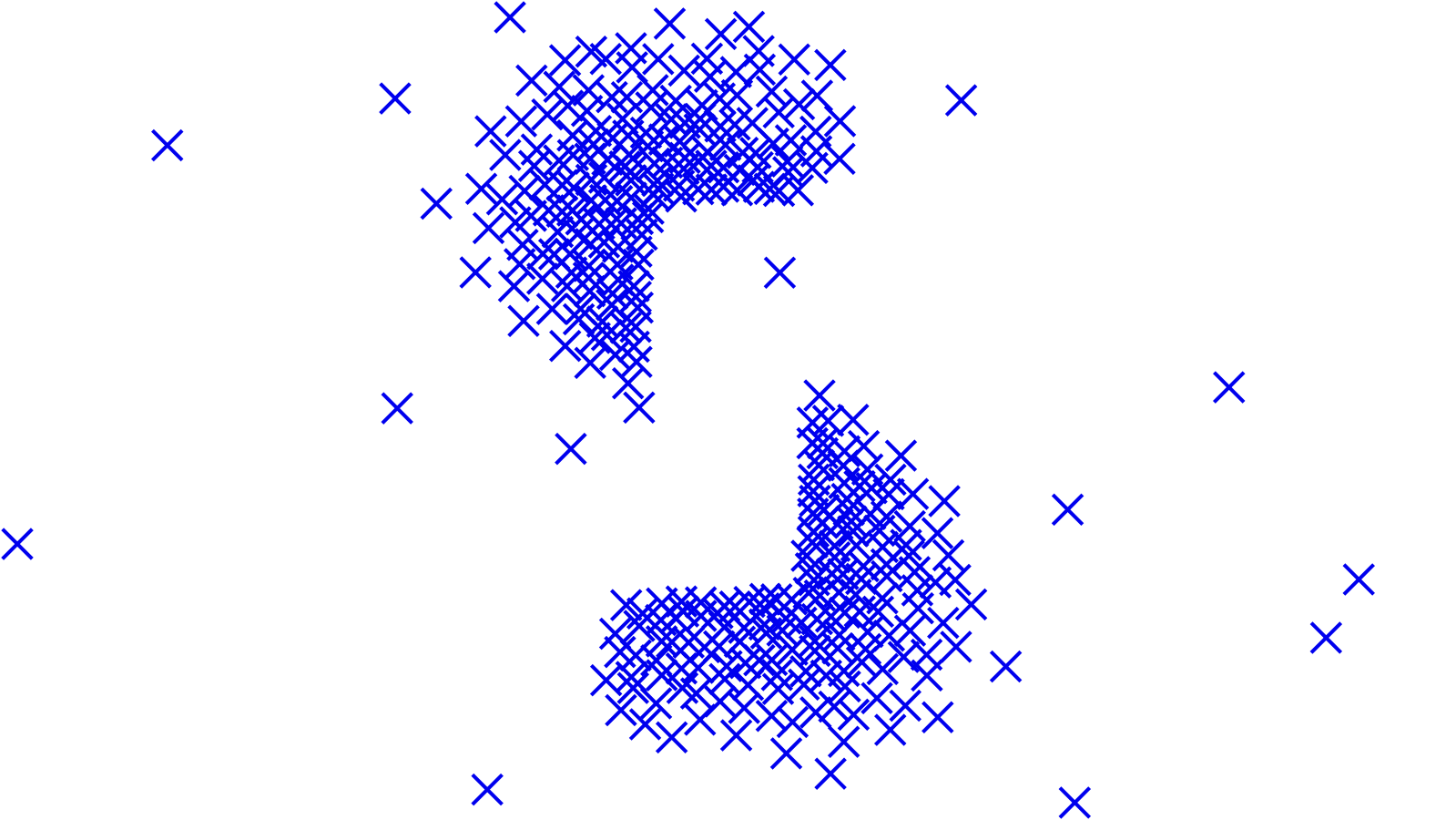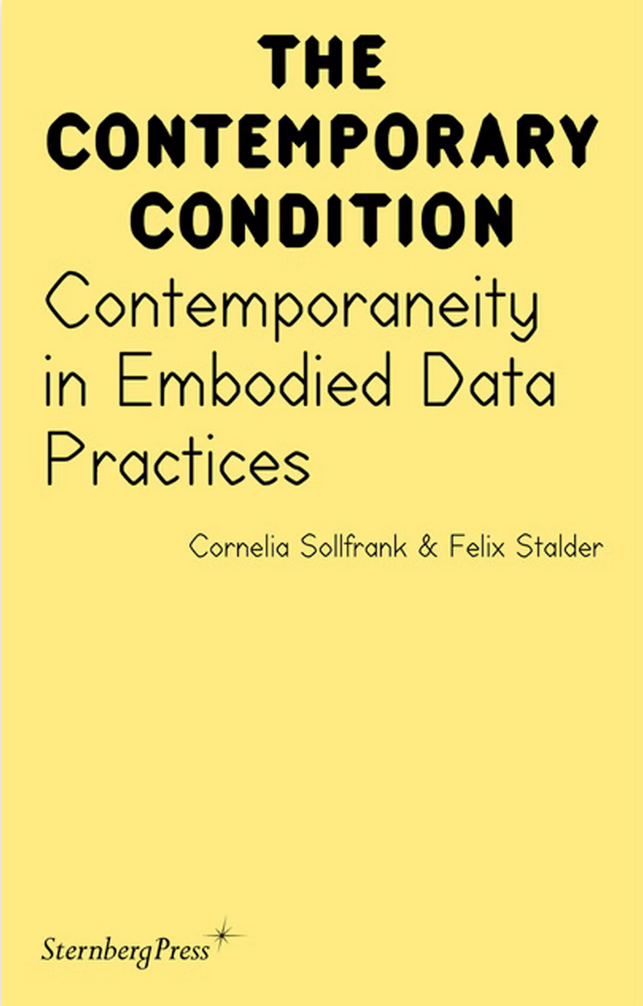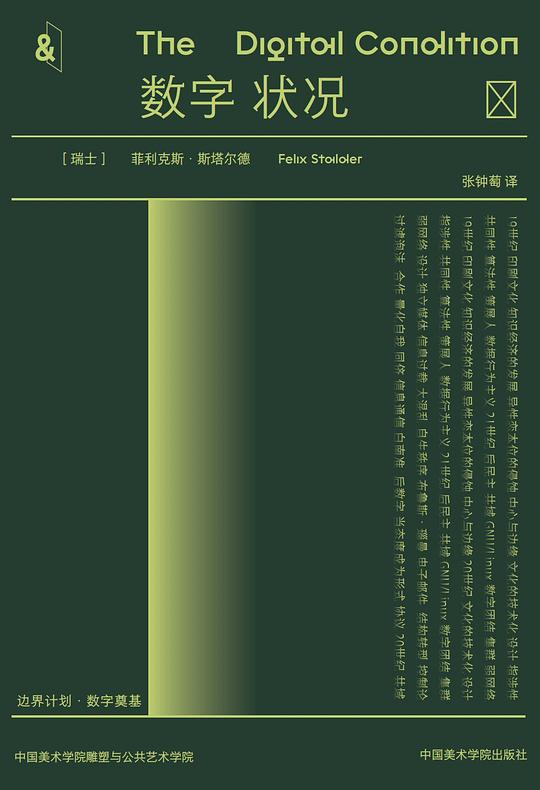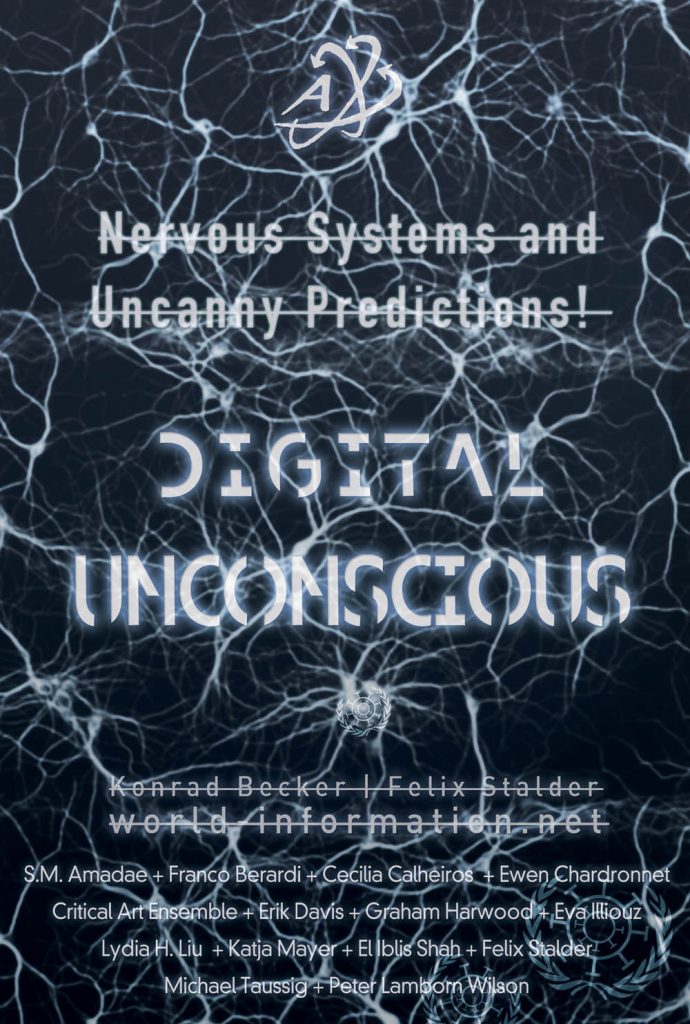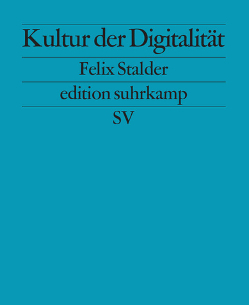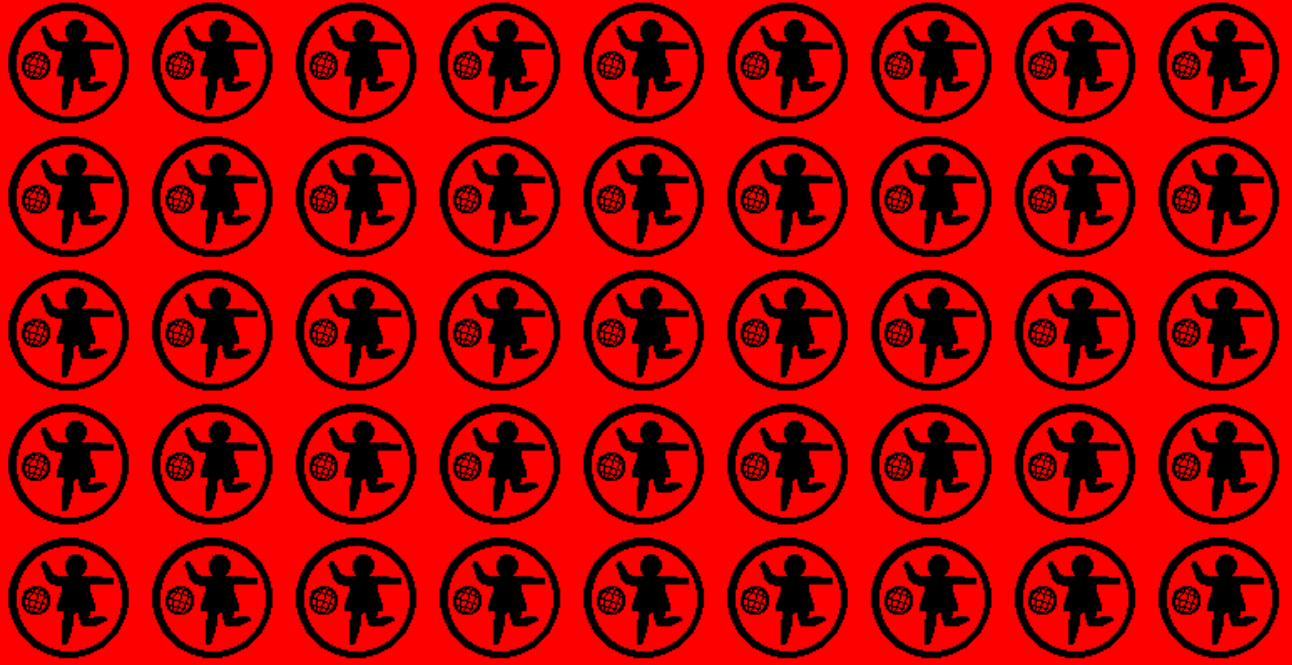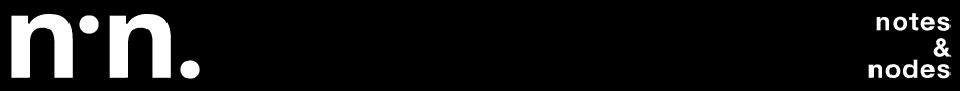
Soeben erschienen bei: european institute for progressive cultural policies
Die Krise des Urheberrechts, die wir in unzähligen Episoden tagtäglich erleben, ist im Grunde nichts Anderes als die Krise des fordistischen Produktionsmodells in den Kulturindustrien. Diese Krise ist aber dramatischer als in anderen Sektoren, denn nirgendwo sonst war dieses Modell so prägend für die Identität der bürgerlichen Gesellschaft, ist es so tief verankert in ihren gesellschaftlichen Institutionen oder reicht es so weit zurück. Nämlich bis 1452. Die Druckerpresse war eine fordistische Maschine avant la lettre in dem Sinn, dass sie es erlaubte, Produkte in kapital- und technologieintensiven, arbeitsteiligen Prozessen in grossen Stückzahlen für überregionale Märkte zu produzieren.
Das Fordistische Modell entsteht
Für die AutorInnen bedeutete das neue Modell, dass sie sich aus der feudalen Abhängigkeit von adeligen oder kirchlichen Würdenträgern lösen konnten. Sie mussten ihre Werke nicht mehr dem Ruhm und der Ehre ihres Gönners widmen. Stattdessen konnten sie für expandierende Märkte in Literatur und Wissenschaft produzieren, die von den VerlegerInnen organisiert wurden.
Für AutorInnen war das in vielfacher Hinsicht ein Autonomiegewinn, denn nicht nur standen die VerlegerInnen in Konkurrenz zu einander, was den Spielraum der AutorInnen vergrößerte, sondern alle TeilnehmerInnen an diesen Märkten – die AutorInnen, die VerlegerInnen aber auch die LeserInnen – stammten zunächst aus der selben sozialen Schicht, dem aufstrebenden BürgerInnentum, was sie zu natürlichen Verbündeten in vielen Auseinandersetzungen machte. So auch beim Urheberrecht, dessen Entstehung eng mit der Expansion der Märkte für literarische Erzeugnisse zusammen hängt. Dennoch, bei genauer Betrachtung lässt sich leicht erkennen, dass das Urheberrecht von Anfang an vor allem sehr eng mit der VerlegerInnenperspektive verbunden war. Das erste moderne Gesetz, das britische Statute of Anne von 1710, repräsentierte das Interesse der VerlegerInnen, sich von den obrigkeitsstaatlichen Druckmonopolen, die ihnen verliehen und wieder entzogen werden konnten, zu befreien. Sie wurden durch ideelle AutorInnenmonopole ersetzt, die in der Praxis den VerlegerInnen vertraglich übertragen werden mussten, um publiziert werden zu können. Auch die kontinentaleuropäische droit d'auteur-Tradition, die die unveräußerlichen Rechte der AutorInnen in den Mittelpunkt stellt, stammt von den VerlegerInnen. Denn Denis Diderots berühmtes Argument, dass die Beziehung zwischen dem/der AutorIn und seinem/ihrem Werk enger sei als jede andere Form des Besitzes, weil das Werk ja im Grunde einen Teil der Persönlichkeit des/der AutorIn darstelle, stammt aus dem Brief über den Buchhandel (1763), welchen er im Auftrag der Pariser Buchgilde verfasste. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dieser Brief zunächst in entstellter Weise und im Namen eines Verlegers, ohne jeden Hinweis auf die Autorschaft Diderots, veröffentlicht wurde.[1] Dennoch, trotz vielfacher Spannungen, lagen die Interessen der AutorInnen, der VerlegerInnen und des Publikums im Grund genommen lange sehr nahe beieinander. Sie waren die zentralen AkteurInnen der bürgerlich-demokratischen Öffentlichkeit. Das Urheberrecht erlaubte es den VerlegerInnen, sich die relevanten Rechte übertragen zu lassen, und sich zugleich vor der Konkurrenz zu schützen, in dem sie zumeist Verwertungsmonopole erlangten. Die AutorInnen konnten sich Anteile an den Einnahmen der VerlegerInnen vertraglich sichern. Dem neuen, städtischen Publikum sicherte es die Versorgung mit Büchern, die auf seine Bedürfnisse und kulturellen Präferenzen zugeschnitten waren. Gleichzeitig erlaubte die im Urheberrecht verankerte Zitatschranke, den essenziell kumulativen Charakter kreativer Arbeit in der literarischen und wissenschaftlichen Praxis zu erhalten, auch wenn er ideologisch vom Geniekult und dem Mythos des/der ErfinderIn verdeckt wurde.
... und breitet sich aus
Dieses Modell, das den literarischen Markt im wesentlichen seit dem 18. Jahrhundert prägte, wurde auf die anderen Kultursparten übertragen, sobald diese technisch in der Lage waren, reproduzierbare Werke in grossen Stückzahlen herzustellen. Allerdings trat das Wissen um den kumulativen Charakter kreativer Arbeit immer weiter in den Hintergrund. In keiner anderen Sparte gibt eine Möglichkeit, so frei mit fremdem Material zu arbeiten, wie es die Zitatschranke für Text ermöglicht. Solange die Medien analog waren,[2] war diese Fehlkonzeption in der Praxis nur ein marginales Problem, weil die Materialität der reproduzierten Werke eine direkte Weiterverarbeitung schwierig machte, und wo sie dennoch geschah (etwa in der Collage), sahen die RechteinhaberInnen keine Veranlassung, ihre Rechte durchzusetzen. Darüber hinaus wurde die kulturelle Produktion der Bevölkerung in ihrem Alltag vom Urheberrecht gar nicht berührt, denn sie war überhaupt nicht auf Reproduktion in grossen Stückzahlen ausgerichtet. Entsprechend wurde der Sphäre des Privaten zugeordnet, die in der bürgerlichen Gesellschaftsordnung per Definition als der Bereich des Nicht-Produktiven – und daher ökonomisch irrelevanten – angesehen wurde.
Dieses Setting, das sehr lange relativ gut funktionierte, fällt seit der Digitalisierung auseinander. Der Fordismus kommt auch in den Kulturindustrien an sein Ende. Es entsteht ein Feld tiefer gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, denn es handelt sich nicht nur um eine ökonomische Krise, sondern auch um eine Identität der bürgerlichen Öffentlichkeit. Kulturpolitik ist auf einmal wieder relevant geworden.
Kämpfe um die neuen Kulturindustrien
Die konservativ-reaktionäre Strategie in den Auseinandersetzungen lässt sich in etwa so zusammenfassen: Je einfacher es ist, eine Kopie herzustellen und zugänglich zu machen, desto stärker müssen die Rechtsmittel sein, mit denen dies verhindert werden kann. Diese Strategie erzielte einen ersten großen Erfolg 1996, als mit dem WIPO Copyright Treaty der Schutz digitaler Kopierschutzmaßnahmen im internationalen Recht verankert wurde. Von nun an stand es unter Strafe, den Kopierschutz, den die Rechteverwerter um ein digitales Produkt legten, zu umgehen, auch wenn die angestrebte Verwendung (etwa, Privatkopie) an sich nach wie vor legal war. Das Recht war de facto privatisiert worden. Von nun an konnte der Rechteinhaber bis ins Kleinste entscheiden, was ein/e NutzerIn mit dem digitalen Werk machen konnte. Bestehende Schranken dieser Verfügungsgewalt sollten durch die Hintertür aufgehoben werden. In der Praxis ließ sich das aber nicht durchsetzen und es folgte eine lange Reihe von weiteren Verschärfungen des Urheberrechts, die alle auf das selbe abzielen: Je mächtiger die Technologien der individuellen Kommunikation, desto umfassender müssen die Kontrollen eben dieser Kommunikation sein, denn Urheberrechtsverletzungen können immer und überall geschehen und einmal der Kontrolle entglitten, lassen sich die digitalen Kopien kaum mehr einfangen. Dass daraus enorme Kollateralschäden für den Schutz der Privatsphäre, für die Rede-, Kunst- und Kommunikationsfreiheit entstehen, wurde von den kulturindustriellen Lobbygruppen nicht wahrgenommen, wohl auch, weil im fordistischen Modell die KonsumentInnen diese Rechte gar nicht brauchen, werden sie doch als passive EndverbraucherInnen, und nicht als aktive TeilnehmerInnen in einem kommunikativen Kreislauf gesehen.
Die europaweiten Demonstrationen gegen das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), die im Februar 2012 stattfanden, zeigen, dass die gesellschaftliche Legitimation des fordistischen Modells der Kulturindustrien schwindet und dass die besonders die „KonsumentInnen“ ihre passive Rolle, auf die sie in diesem Modell festgeschrieben sind, nicht mehr akzeptieren. Ganz im Gegenteil, sind auch für sie die öffentliche Kommunikation, das Erstellen und Vertreiben kultureller Werke zu einem wesentlichen Aspekt ihres Alltagshandelns und ihrer Selbstdefinition geworden. Mit anderen Worten, das Ende des fordistischen Modells hat den Handlungsspielraum für einen Großteil der Bevölkerung deutlich erweitert, denn es entstehen laufend neue Rollen, die irgendwo zwischen den AutorInnen alter Schule und den passiven KonsumentInnen angesiedelt sind. Jeder Eingriff in die Möglichkeiten der öffentlichen Kommunikation, die notwendigerweise beschränkt werden muss, um das alte Modell zu erhalten, wird als direkter Eingriff in die neuen Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung wahrgenommen und entsprechend deutlich abgelehnt. Die KonsumentInnen haben sich aus dem fordistischen Modell verabschiedet, entwickeln neue Identitäten jenseits der Trennung zwischen öffentlicher und privater Kommunikation. Sie schauen nicht mehr zurück.
Ebenfalls relativ klar ist die Lage für die Kulturindustrien, wo sich sie alten Industrien – die Verleger, Labels, Vertriebe, usw. – dagegen wehren, von den neuen AkteurInnen – Google, Facebook, Amazon etc – verdrängt zu werden. Das Urheberrecht ist die zentrale Waffe in diesen Kampf. Damit versuchen sie, dem Aufstieg der neuen Kulturindustrien Einhalt zu gebieten, oder zumindest den Preis des allfälligen Ausverkaufs zu erhöhen.
Am widersprüchlichsten ist die Rolle der professionellen KünstlerInnen. Zum einen offerieren die etablierten Modelle den meisten von ihnen kaum eine realistische Chance auf ein faires Einkommen – die Prekarisierung im Kultursektor ist weit fortgeschritten. Dies wird sich auch nicht verbessern, da der Bereich der Kultur, der nach fordistischen Prinzipien organisiert wird, kleiner und die Logik der großen Stückzahl härter durchgesetzt wird. Es wird mehr Geld in immer weniger Stars investiert und die alten Nischen verschwinden. Zum anderen besteht große Skepsis davor, sich in Abhängigkeit von neuen VermittlerInnen zu begeben, die ihrer Märkte durch Quasi-Monopole kontrollieren und ihre entsprechende Marktmacht knallhart ausnützen. In dieser Situation ziehen es viele KünstlerInnen vor, sich nicht zu diesem Konflikt zu äußern.
Neue Soziale Ökonomien?
Dabei ist die Alternative zwischen Kulturindustrie1.0 und Kulturindustrie2.0 eine falsche. Vor unseren Augen entsteht ein drittes Modell, eine neue soziale Ökonomie im Kulturbereich, indem ProduzentInnen und RezipientInnen in ein flexibles und kooperatives Verhältnis zu einander treten. Soziale, kulturelle und ökonomische Dimensionen werden neu miteinander verknüpft, anstatt sie strikt voneinander zu trennen. Das Publikum wird ermächtigt, seine Anerkennung der Leistungen der KünstlerInnen nicht nur durch Bezahlung an der Kasse und mittels Applaus in Gegenwart der KünstlerInnen zum Ausdruck zu bringen, sondern sich durch verschiedene Aktivitäten in die Produktion einzubringen und sei es nur, dass sie sich mittels Crowd-funding an der Vorfinanzierung eines neues Werks beteiligen. Das erfordert aber ein Umdenken von Seiten der KünstlerInnen und ein verändertes Verhältnis zum Publikum. Hat die Entstehung des fordistischen Modells den AutorInnen erlaubt, sich aus der persönlichen, hierarchischen Abhängigkeit des feudalen Mäzenatentums zu lösen und in eine abstrakte, marktvermittelte Gleichheit zu ihrem Publikum zu treten, so bietet die aktuelle Situation die Möglichkeit, sich von der abstrakten Gleichheit des Marktes zu lösen und in eine hochgradig persönliche und gleichberechtigte Beziehung zum Publikum zu treten. Keine einfache, aber eine sehr vielsprechende Herausforderung, die weit über den Kulturbereich im engeren Sinne hinaus weist.
[1] Den Verlegern war die Betonung der Autorenrechte etwas zu empathisch ausgefallen. Die Originalfassung wurde erst rund 100 Jahre später veröffentlicht. http://www.copyrighthistory.org/cgi-bin/kleioc/0010/exec/ausgabeCom/%22f...
[2] Es lässt sich argumentieren, dass Text schon immer eine digitale Logik hatte, in dem Sinne, dass er aus diskreten Symbolen besteht, die sich verlustfrei kopieren lassen und die einfach neu zu arrangieren sind. Siehe etwas: Florian Cramer (2004), 10 Thesen zur Softwarekunst. http://www.netzliteratur.net/cramer/thesen_softwarekunst.html
Mit Untersützung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, Abt.IA/4.