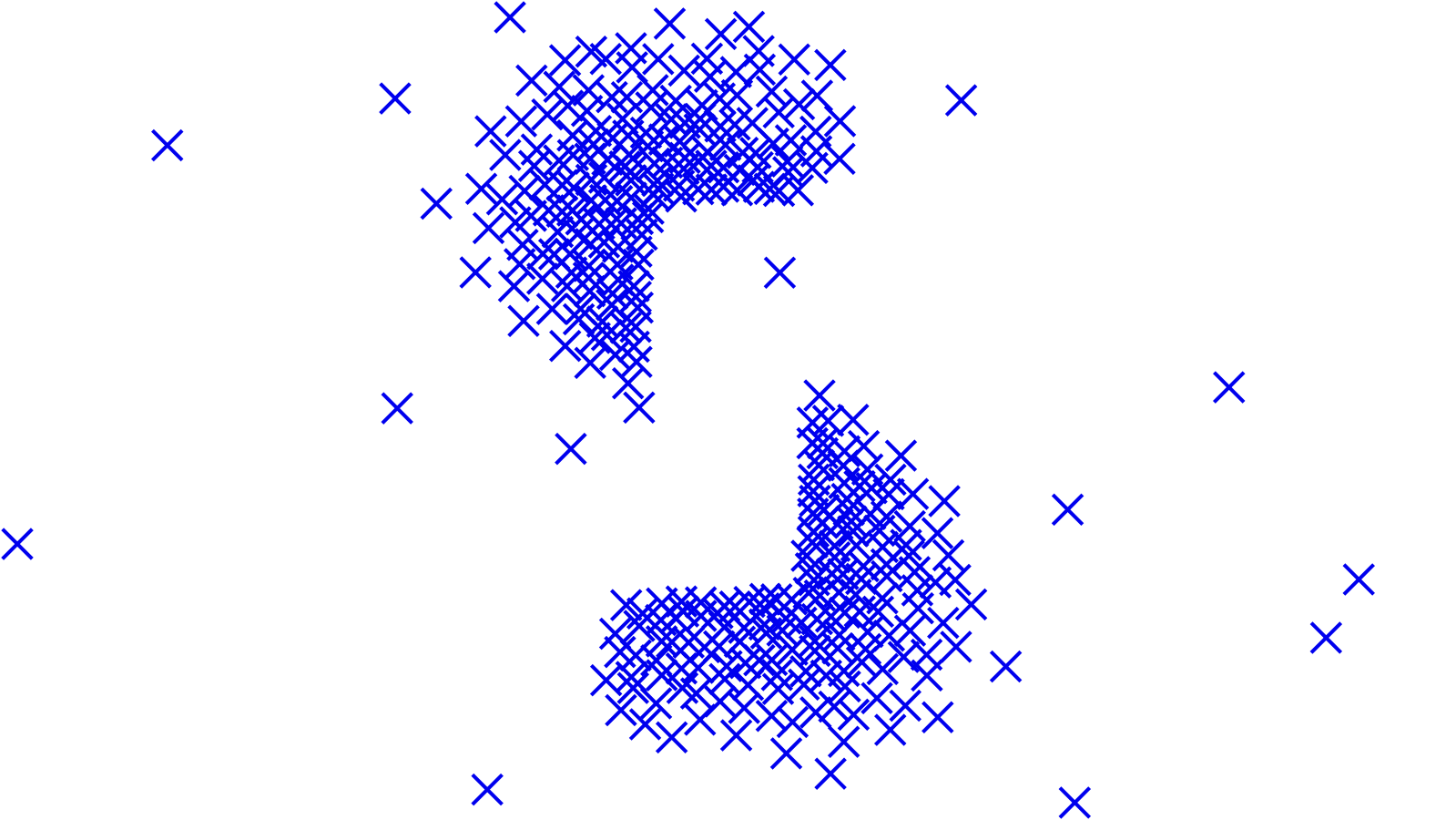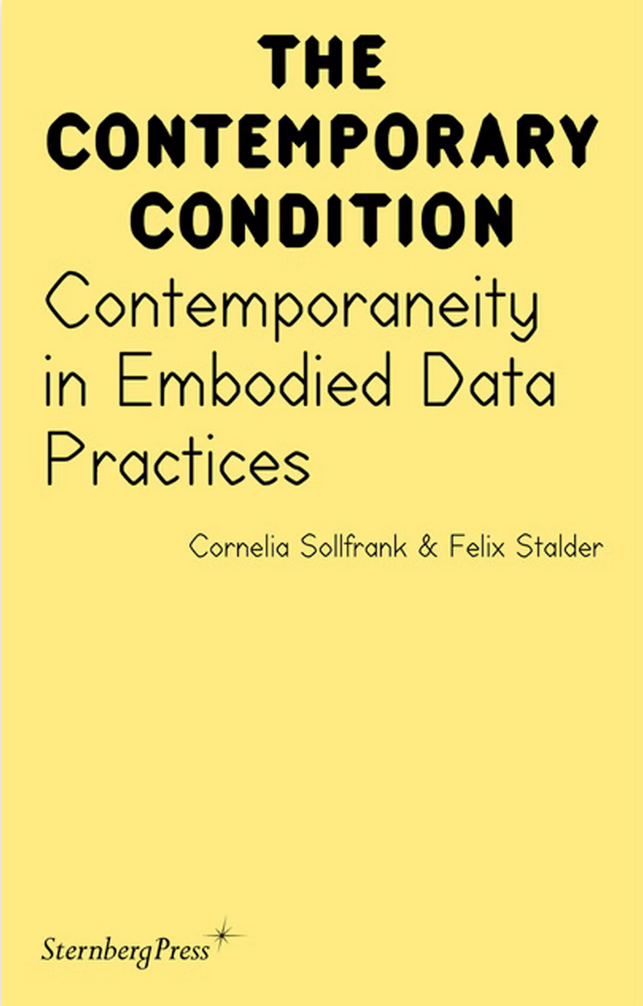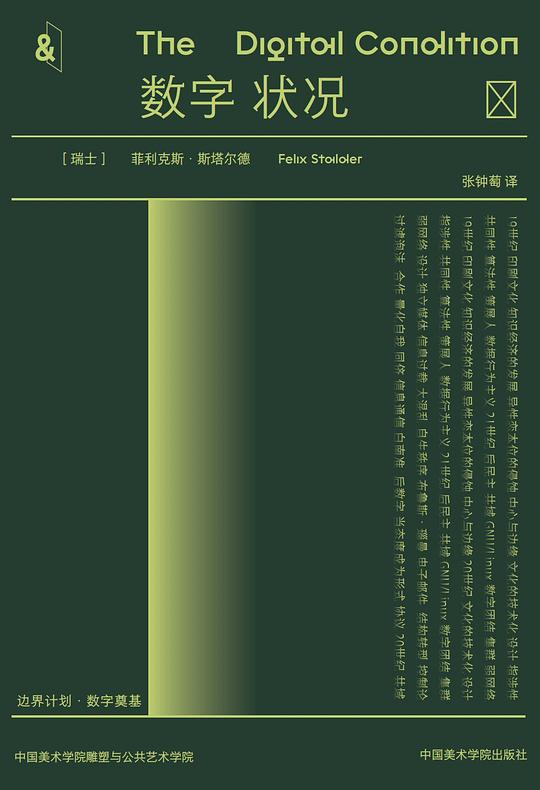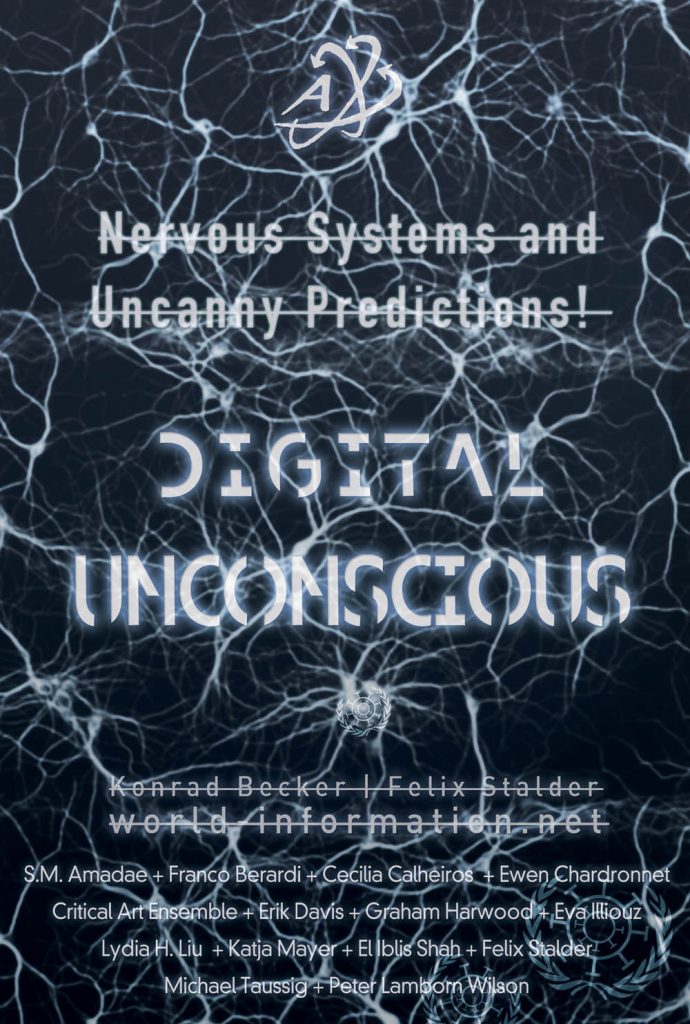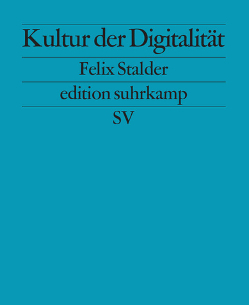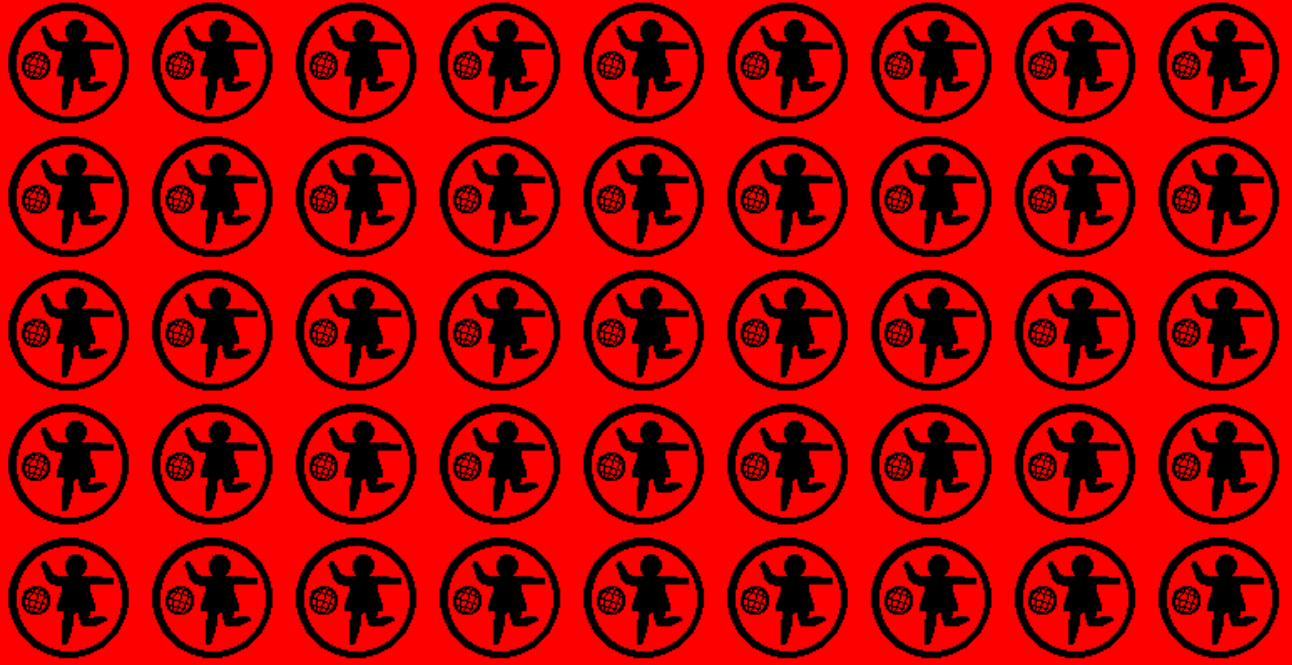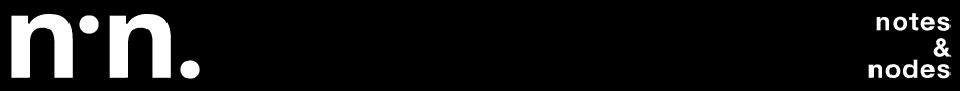
Rezension von Felix Stalder (2016) ”Kultur der Digitalität”, Frankfurt/Main: Suhrkamp
von Theo Röhle in Zeitschrift für Medien & Kommunikationswissenschaft Jahrgang 64 (2016) Heft 4, S. 573. (veröffentlicht hier mit freundlicher Genehmigung von M&K)
Angesichts der Komplexität gegenwärtiger medialer Konstellationen bedarf es schon etwas Mut, den großen Wurf zu wagen und die ”Kultur der Digitalität" auf einen Nenner bringen zu wollen. Das Risiko, die Dinge verkürzt und verengt darzustellen, liegt auf der Hand. Und die meisten vermeiden es, indem sie ausschließlich auf bestimmte Aspekte, Entwicklungen oder Gegenstände fokussieren. Allerdings muss man sagen: Der Mut hat sich gelohnt. Der Band von Felix Stalder durchquert sehr unterschiedliche Felder, setzt sie auf teilweise unerwartete Weise zueinander in Beziehung und eröffnet gerade dadurch neue Perspektiven.
Der dreigeteilte Aufbau – grob gesagt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – ist stringent und eingängig. Im ersten Teil werden die ”Wege in die Digitalität" nachgezeichnet, die Voraussetzungen für die gegenwärtige Kultur der Digitalität geschaffen haben. Erfrischenderweise spielt die Technik in dieser Erzählung zunächst eine untergeordnete Rolle. Unter den Stichworten Wissensökonomie, Erosion der Heteronormativität und Postkolonialismus treten stattdessen die Konturen gesellschaftlicher Veränderungen und Kämpfe hervor, die eine erweiterte Teilhabe an kulturellen Aushandlungsprozessen überhaupt erst ermöglichten. Anschließend geht es um die Erweiterung des Felds des Kulturellen, z.B. durch die Etablierung einschlägiger Methoden der kulturellen Produktion wie Appropriation und Rekombination. Das Netz als medientechnische Infrastruktur erlangt, so Stalder, seine heutige Bedeutung vor allem deshalb, weil es just zu einem Zeitpunkt allgemein zugänglich wird, als diese kulturellen Entwicklungen bereits ihren Höhepunkt erreicht hatten. Es schuf einen Handlungsraum, der sowohl kompatibel ist mit neuen gesellschaftlichen Anforderungen an Subjekte als auch mit inzwischen im Mainstream angelangten kulturellen Praktiken, die auf die Ausbildung differenter Identitäten abzielen.
Analytisch bringt Stalder im zweiten Teil die Begriffe Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität in Anschlag, um spezifische ”Formen der Digitalität" zu unterscheiden. Referentialität kennzeichnet er als ”eine Methode, mit der sich Einzelne in kulturelle Prozesse einschreiben und als Produzenten konstituieren können" (95). Damit ist ein adäquates Niveau der Abstraktion erreicht und der normative Duktus, mit dem neue Möglichkeiten der kulturellen Produktion oftmals diskutiert werden, bleibt aus. Zentral ist zudem die kollektive Dimension – zur Diskussion stehen immer soziale Zusammenhänge. Den Begriff der Gemeinschaftlichkeit verortet Stalder dabei explizit in der Nähe des von Jean Lave und Etienne Wenger geprägten Begriffs ”community of practice” und problematisiert damit die traditionelle Gegenüberstellung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Algorithmizität betrifft schließlich die Art und Weise, wie Maschinen an kulturellen Prozessen beteiligt sind, vor allem, indem sie Ordnungen und Sortierungen vornehmen, deren Kriterien schwer durchschaubar und angreifbar sind und somit neue Formen der Abhängigkeit und Beeinflussung hervorbringen.
Der dritte Teil bietet einen Ausblick, indem zwei ”Richtungen des Politischen in der Digitalität” skizziert werden. Im Anschluss an Jacques Rancière und Colin Crouch wird zunächst eine post-demokratische Entwicklungslinie entworfen, bei der Input-Legitimität zunehmend durch Output-Legitimität ersetzt wird. Politisches Handeln und gesellschaftliche Institutionen werden nicht mehr über die ethischen Prinzipien legitimiert, die ihnen zugrunde liegen, sondern durch die Resultate und Vorteile, die sie für bestimmte Gruppen generieren. Ins Visier nimmt Stalder hier insbesondere die kommerziellen Social Media-Plattformen, deren intransparente und unzugängliche Entscheidungsprozesse als Prototyp post-demokratischer Entwicklungen gelten können. Die gegenläufige Entwicklungslinie in Richtung gemeinschaftlich verwalteter Commons wird am Beispiel der Wikipedia und Open Source-Projekten wie der Linux-Distribution Debian veranschaulicht.
Diese politische Perspektivierung hätte durchaus mehr Raum verdient. Die Auswahl der Gegenstände eignet sich zwar gut, um die zwei Entwicklungslinien zu illustrieren, aber mit weniger eindeutigen Beispielen hätte man ggf. widersprüchliche Entwicklungen sowie latente Potentiale und Gefahren noch besser herausarbeiten können.
Insgesamt aber überzeugt der Band, weil er drei Qualitäten miteinander verbindet: Die grundlegende soziologische Orientierung sorgt dafür, dass sich die Darstellung nicht in historischen Details verliert – es bestehen keine Hemmungen vor großen Bögen und strukturellen Erklärungen. Die deutliche kulturwissenschaftliche Verankerung sorgt im Gegenzug dafür, dass Probleme der Ästhetik und symbolische Kämpfe nicht aus dem Blickfeld verschwinden, sondern der Fokus konsequent auf Fragen der kulturellen Aushandlung von Bedeutung liegt. Die technische Expertise sorgt schließlich dafür, dass Technik nicht schlicht unter Theorie subsumiert wird und dass die Verschränkungen von Technik und Kultur auch im Detail kompetent analysiert werden.
Der Text ist zugänglich und zugleich konzise verfasst, vereinzelt werden Fachbegriffe in den Fußnoten erklärt. In den historischen Abschnitten fühlt man sich stellenweise an den erzählerischen Elan von Adam Curtis erinnert (dessen Dokumentarfilm-Motive an einigen Stellen auch aufgegriffen werden). Insofern ist das Buch sehr gut als Einführung und für ein breites Publikum geeignet. Gleichzeitig enthält es – vor allem durch die Kombination der historischen Stränge und die Relationierung der drei Formen der Digitalität – eine pointierte Synthese gegenwärtiger Debatten zur Digitalität, die im Fachdiskurs zweifellos ihre Spuren hinterlassen wird.